Die Coppola-Familie ist groß und hat einige Mitglieder, die man dort gar nicht vermuten würde. Nic Cage beispielsweise. Ja wirklich! Wie ist es wohl in so einer Familie aufzuwachsen? Mit einem Vater (Francis Ford Copppola) der unvergessliche Meilensteine der Filmgeschichte geschaffen hat wie „Apocalypse Now“ oder der „Godfather-Reihe“? Einerseits wuchs Sofia Coppola in einem Umfeld auf, das ihr bestimmt nicht nur finanziell erlaubte sich kreativ auszuleben. Andererseits war sie sicherlich früh hohen Erwartungen ausgesetzt. Man kann über all das spekulieren, aber was sie umtreibt und die Antwort auf die Frage, ob sie sich von ihrem berühmten Vater künstlerisch absetzen kann, findet man ja doch einzig und allein in ihrem Schaffen. Der gemeinsame Nenner der heute besprochenen Filme ist: Sofia Coppola führte bei ihnen Regie und lieferte teilweise das Drehbuch.
Lick the Star
Lick the Star ist Sofia Coppolas erster Film und mit nur 14 Minuten Spieldauer ein Kurzfilm. Er enthält bereits Elemente, die charakteristisch für ihr späteres Schaffen sein werden. Schauplatz ist eine High School und der Film handelt von einigen Mädchen, die sich um die Bienenkönigin Chloe scharen. Entweder man liebt oder man hasst sie. Das Gerede ist sie gewöhnt, aber auch die Bewunderung. Ihr Selbstbewusstsein übertrifft das alles noch um einiges mehr und sie ist um keinen Spruch verlegen. Als Chloe sich einen fiesen Plan ausdenkt und den Schlachtruf Lick the Star, hinterfragen ihre stummen „Follower“ das Ganze kaum und machen erstmal mit. Bis sich Chloe durch einen Zufall etwas leistet, das nicht cool ist. Und alle Wind davon bekommen. Coppolas Kurzfilm handelt eigentlich von einem Mädchen, das zu der Clique der coolen Chloe gehören wollte und als diese zerfällt und Chloe offiziell nicht mehr cool ist, sehnsuchtsvoll dem Mädchen hinterhersieht. Aber weniger wegen der verlorenen Freundschaft, dem negativen Gerede an der Schule, sondern weil es diese Clique nicht mehr gibt, deren Aura sie so magisch anzog und zu der sie dazugehörte. Es ist der Ausdruck des Etmystifizierens und Entzauberns. Bei Lick the Star werden die meisten an die ungeschriebenen Gesetze ihrer Schulzeit denken, das feingliedrige soziale Gefüge und die cool kids. Wobei es um letztere weniger geht, sondern darum wie Cliquen und kollektive Meinungen Außenwirkung und Alltag einer Person bestimmen können. Ich behaupte einfach mal es gibt kein Umfeld, auf dem man das so gut bemerken kann wie in Schulen. Das einzige was den Spaß trübt ist die unprofessionell wirkende Ab-und-zu-shaky-cam. Die verwaschene Optik ist Geschmackssache, erinnert aber effizient an Erinnerungen.
Lick the Star, USA, 1998, Sofia Coppola, 14 min, (8/10)

„The Virgin Suicides Trailer (1999)“, via glows (Youtube)
The Virgin Suicides
In einem beschaulichen Vorort im Michigan der 1970er Jahre sind die Lisbon-Töchter der Inhalt der Tagträume und Gedanken einer Gruppe Jungs. Zuerst weil sie alle gleichermaßen schön, ruhig und geheimnisvoll wirken. Sie sind die, die alle um ein Date bitten oder mit ihnen befreundet sein wollen und es ist als würde das Licht angehen, sobald sie elfenhaft den Raum betreten. So zumindest ist die Erinnerung der Jungs an die Lisbon-Töchter. Die Mädchen sind Cecilia (Hanna R. Hall) – die jüngste, Lux (Kirsten Dunst) – die Aufmüpfige, Bonnie (Chelse Swain ), Mary (A. J. Cook) und Therese (Leslie Hayma) – die älteste. Vielleicht sind sie aber auch erst durch die Selbstmorde zum Mythos geworden. Es fing alles an mit Cecilia, deren erster Selbstmordversuch scheiterte. Sie erklärt niemandem warum. Die Jungen der Nachbarschaft erinnern sich an das Jahr ab diesem markanten Datum und was mit den Lisbon-Schwestern passierte. Die Ereignisse zurückzuverfolgen und die Gründe für das Handeln der Mädchen zu ergründen wird ihre Aufgabe, wann immer sie sich sehen. Die im Rückblick erzählte Geschichte der Lisbon-Schwestern ist für den Zuschauer vielleicht ein weniger großer Mythos angesichts der Enttäuschungen durch ihre Umwelt, die die Mädchen scheinbar stumm ertragen. Die beginnen mit ihren überfürsorglichen Eltern, die sie von der Außenwelt abschirmen oder angesichts der Schuljungs wie Josh Hartnett als Herzensbrecher Trip Fontaine. Vor Allem ist The Virgin Suicides aber eine bittersüße Ode an das Erwachsenwerden und unser schwelgerisches Erinnern daran. So ist es beispielsweise der Mythos rund um die Lisbon-Mädchen und die Frage: sind sie vielleicht erst durch die „Virgin Suicides“ zu diesem Mythos geworden? Warum wählt jemand den Freitod, der noch ein ganzes Leben vor sich hat? Das zu ergründen liegt beim Zuschauer und wurde von Sofia Coppola in ein schwelgerisches Drama gegossen, das mit uns ganz ähnliches anstellt. Wir denken an den Ballkönig und die Ballkönigin unserer Schulzeit, an die Menschen die sang- und klanglos verschwanden oder daran „Was wurde eigentlich aus dem Nachbarsjungen“? Hatte nicht jeder von uns seine Mythen, die heute in einem ganz anderen Licht erscheinen? Coppolas Film umarmt das Motiv und unterstreicht den krassen Akt und das Thema Erwachsenwerden nochmal doppelt, streut etwas Glitzer auf und ein paar kitschige Aufkleber. Und es dient der Sache wunderbar. Ein Film wie ein lauer Sommerabend mit bitteren Erinnerungen und einem Hauch Gesellschaftskritik angesichts der Eltern, die ihre Mädchen so erfolgreich in den Suizid treiben.
The Virgin Suicides, USA, 1999, Sofia Coppola, 97 min, (9/10)

Marie Antoinette
Sofia Coppola sagte, dass ihr Film über Marie Antoinette vor Allem die Geschichte einer Frau erzählen sollte, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gelebt hat. Und das unterstreicht Coppola wunderbar indem sie eben keinen Historienfilm macht. Die Kleider sind etwas bunter und wenn man genau hinschaut, dann sieht auch mal irgendwo zwischen den Schuhen ein Paar Chucks stehen. Das Leben Marie Antoinettes wird von Indie-Musik und Rock begleitet. Sehr passend, wenn man bedenkt, dass sie als Vierzehnjährige von Österreich nach Frankreich reiste um dort den französischen Thronfolger zu heiraten, der der Aufgabe „Ehe“ zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht gewachsen ist. Das Gefühl die Heimat zu verlassen und an einem fremden Ort hohe Erwartungen erfüllen zu müssen erklärt die melancholische Indie-Mucke. Ihre Rebellion gegen den Zirkus zu Hofe des Königs erklärt den Punk. Sie wurde nicht umsonst rebel queen genannt. Und sie traut sich auch auszusprechen wie absurd der eine oder andere Brauch ist. Bestes Beispiel ist wohl die morgendliche Ankleide-Zeremonie oder auch ihr anfangs sehr stiller Ehemann und späterer König. Der Film illustriert mit einem pompösen Feuerwerk woher das rebel in rebel queen kommt und warum es kommt. Marie Antoinette hätte einfach ein Mädchen sein sollen, wurde aber zu früh in die Rolle einer Ehefrau, Mutter und Königin gepresst. Man spürt wie sie sich an den schönen Dingen des Lebens versucht festzukrallen und mit ihnen untergeht. Und trotz ALlem ist sie eine Figur, die wir bedauern, obwohl die Geschichte uns da mehr lehrt. Aber historische Korrektheit ist nicht der Punkt. Coppolas Idee von einer Frau, die zur falschen Zeit geboren wurde, ist es. Das einzige was mich davon abhält nicht mehr Punkte zu geben ist, dass der Film in seinen Stilbrüchen mit historischen Verfilmungen eigentlich noch krasser hätte sein können.
Marie Antoinette, USA, 2006, Sofia Coppola, 123 min, (8/10)

„Marie Antoinette (2006) Official Trailer 1 – Kirsten Dunst Movie“, via Movieclips Classic Trailers (Youtube)
Somewhere
Es gibt wahrscheinlich kaum einen Film, der die Absurdität der Traumindustrie und des Star-Daseins besser darstellt. In Somewhere lebt der Schauspieler Johnny Marco (Stephen Dorff) in Lethargie von einer Party zum nächsten Pressetermin. Wann irgendein Termin ansteht und was er gerade filmt, interessiert ihn null. Sein Leben ist gepflegte Langeweile und das transportiert auch Sofia Coppolas Film. Mit Absicht. Minutenlanges rumsitzen, rauchen, trinken, starren – auf Nichts. Und der Zuschauer ist voll dabei, sitzt in der ersten Reihe. Johnny schläft sogar auf den Frauen ein, die er gerade abschleppt. Jemand gibt eine Party in seiner Wohnung? Alles egal. Nichts besonderes. Manch einer interpretiert das als coole Attitüde, der Zuschauer steigt schon dahinter, nur Johnny selber brauch ein bisschen um die Leere in seinem Leben zu verstehen. Ausschlaggebend ist seine Tochter (Elle Fanning), die mit ihm reist und in Hotels chillt, während ihre Mutter sich eine Auszeit nimmt. Und der tadelnde Blick mit dem sie die flüchtigen Frauenbekanntschaften ihres Vaters am Frühstückstisch quittiert ist unbezahlbar. So verfehlt der Film gegen Ende nicht seine Wirkung, nur die lange Exposition raubt einem Nerven. Die Absurdität des Starrummels wird am deutlichsten, wenn klar ist wie wenig man Johnny über die Termine sagt zu denen er geht. Er soll einen Preis entgegen nehmen? Stattdessen tanzen plötzlich halbnackte Frauen. Er hat einen Pressetermin in Italien? Oh, er soll sich eigentlich ins Stadtbuch eintragen. Und schon sieht Star-Sein gar nicht mehr glamourös aus. Schade nur, dass man bis zu diesen einzelnen Höhepunkten des Films immer soviel von Johnnys Leerlauf mitnehmen muss. Eine Nebenrolle spielt außerdem das Chateau Marmont Hotel, das zwar nicht wie eine typische Star-Residenz aussieht, aber eine bewegte Vergangenheit hat.
Somewhere, USA, 2010, Sofia Coppola, 98 min, (6/10)

The Bling Ring
Im Opening zu Coppolas The Bling Ring liest man etwas seltenes, nämlich dass er auf einem Vanity Fair Artikel („The Suspects Wore Louboutins“) basiert. Kein Buch, kein Comic – aber wahre Tatsachen. Der Bling Ring ist eine Gruppe Upper-Class-Teenager, die in die Häuser von Prominenten einbrechen. Darüber, ob sie es nötig haben, lässt sich streiten. Sie leben kein schlechtes Leben, aber sie eifern Prominenten nach, Trends, Lifestyle und Mode und wollen ein Scheibchen vom „Fame“ abhaben. Insbesondere Marc (Israel Broussard), der neu an der Schule ist, will dazugehören und ist glücklich, dass er durch Rebecca (Katie Chang) Anschluss findet. Dass sie gern mal checkt, ob Autos offen sind und Brieftaschen darin liegen, ist anfangs ein witziger Gag. Dann sind es Villen von Bekannten. Sie lassen mal eine Tasche mitgehen – gibt ja genug. Und plötzlich sind es die Villen von Paris Hilton und Lindsay Lohan und sie halten sich beim Stehlen kaum noch zurück. Zu ihrer Runde gesellen sich bald mehr und mehr Leute, die ebenso wie die Beiden nicht hinterfragen, was sie da abziehen. Darunter die Schwestern Nicki (Emma Watson) und Sam (Taissa Farmiga), auch was den Cast betrifft ein Schaulaufen von Jungstars.
Jungstars, Schaulaufen, O-Ton und Synchro hin oder her, nicht alle wirken so ganz überzeugend. Trotz des allgemeinen Lobs kann auf den einen oder anderen Emma Watsons Performance des ignoranten Teenagers sehr over-the-top wirken. Aber wo ist überhaupt das Maß? Die Teenager strotzen nur so vor Doppelmoral: einerseits lieben sie die Stars, ihre Styles; andererseits haben sie kein Problem damit sie zu beklauen. Die Gruppe ist desillusioniert und verwöhnt von einem (bisher) konsequenzenlosen Leben, in dem sie sich gehen lassen können wie es ihnen beliebt. Woher diese interessanten Ansichten über das Leben kommen, erklärt der Film zum Teil. Zerrüttetes Elternhaus oder esorerisch angehauchte Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder für eine Modelausbildung zuhause „unterrichten“. Mh. Ja. Anders ist nicht immer schlechter, aber sagen wir mal so: denen hat es nicht geholfen. Was dem Zuschauer nur mäßig hilft ist das abrupte Ende. Was verwöhnten Zuschauern gar nicht hilft für die große Lehre des Lebens: der Film wertet nicht und überlässt es komplett uns. Wenn man mag, kann man den Film so interpretieren, dass die Gruppe gefeiert und glorifiziert wird. Ich bin dafür den Zuschauer zu fordern: aber hier ist es gewagt und wenig hilfreich. Außerdem: wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass Promis ihre Häuser offen stehen lassen oder Schlüssel unter der Fußmatte verstecken?
The Bling Ring, USA, 2013, Sofia Coppola, 90 min, (7/10)

A Very Murray Christmas
In dem 2015 auf Netflix erschienenen Weihnachtsspecial spielt fast die Hälfte des Casts sich selber und frönt einer gewissen Lakonie. Pun intended – Billy Murray soll eine Weihnachtssendung hosten, die live übertragen werden soll. Aufgrund eines Schneesturms kann aber die Hälfte von Cast und Crew nicht anreisen und die Sendung droht im Desaster zu enden. Bill Murray macht ein, zwei verzweifelte Versuche die Übertragung zu retten, landet aber letztendlich in der Hotel-Bar, wo er (vielleicht?) ein glücklicheres Weihnachten als vor den Kameras feiert. Dass er das mit Fremden feiert, die sich ebenso melancholischer Weihnachtsstimmung hingeben, ist ein schöner Twist und macht A Very Murray Christmas zu dem perfekten Kompromiss für diejenigen, die kitschigen Weihnachtsfilmen am liebsten aus dem Weg gehen. Leider wackelt Murrays Rolle und macht eine Gradwanderung gerade in den letzten Minuten, die unklar zeichnet, was er sich nun wünscht. Dem Showrummel zu entkommen oder nicht oder wieder die großen, genialen Shows früherer Zeiten zu inszenieren? Wahrscheinlich ist das dem Zuschauer überlassen wie so oft in Coppolas Skripten.
A Very Murray Christmas, USA, 2015, Sofia Coppola, 56 min, (7/10)

Die Verführten
Sofia Copolas jüngstes Werk ist eine Hommage an den Film Betrogen mit Clint Eastwood aus dem Jahr 1971. Ich sage Hommage und nicht Remake, obwohl die Handlung, wenn man sie herunterbricht dieselbe ist. In Coppolas Film sind die Regeln aber einen Hauch anders. Der Film ist in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs angesiedelt. In einer abgeschiedenen Gegend Virginias leben noch fünf Schülerinnen eines Mädcheninternats zusammen mit ihren Erzieherinnen Martha Farnsworth (Nicole Kidman) und Edwina Morrow (Kirsten Dunst) und versuchen einen normalen Alltag aufrecht zu erhalten, obwohl nichts mehr normal ist. Sie halten jeden Tag nach Soldaten oder Plünderern Ausschau und sehen am Horizont stets Rauchsäulen von Kämpfen, die näher sind, als sie vielleicht möchten. Eines Tages findet Amy (Oona Laurence) einen verletzten Soldaten, der sich als John McBurney (Colin Farrell) vorstellt. Er kämpft für den Norden und ist somit eigentlich der Feind. Die Frauen beschließen ihn zu pflegen und den Südstaaten-Truppen zu übergeben, wenn er transportfähig ist. Soweit kommt es aber nicht.
Als Frau würde ich lieber sagen: natürlich sind sie total unbeeindruckt davon, dass ein Mann im Haus ist, tun stets das Richtige und werfen sich ihm nicht bei der erstbesten Gelegenheit an den Hals. Aber auf eine mal mehr, mal weniger subtile Art und Weise tun sie genau das. Neben den reiferen Frauen, tut das v.A. auch die ambivalente, offensichtlich von ihrer Umwelt gelangweilte Alicia (Elle Fanning), während die jüngeren Schülerinnen sich eher wie an eine Vaterfigur erinnert fühlen, aber trotzdem durch den männlichen Zuwachs im Internat frei drehen. Nach dem ersten Kopfschütteln wird aber klar: sie haben es vielleicht nicht anders kennengelernt. Die Schülerinnen werden in dem Internat nicht auf ein Studium oder akademisches Leben vorbereitet, sondern auf das als gute Gesellschafterin und Hausfrau. Vielleicht ist es also mal wieder die Gesellschaft, die an der Verführung der Frauen nicht ganz unschuldig ist. Es gibt zwar keinen gut hörbaren feministischen Unterton, aber Schwarzweißmalerei gibt es auch nicht. Sowohl der Mann, als auch die Frauen, sind an ihrer Lage gleichwertig beteiligt. Und die wird gegen Ende des Films rabenschwarz.
Die Verführten (OT: The Beguiled), USA, 2017, Sofia Coppola, 93 min, (7/10)

„The Beguiled Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers“, via Movieclips Trailers (Youtube)
Ich würde wetten der Lieblingsfilm der meisten Sofia-Coppola-Fans ist „Lost in Translation“. Übrigens auch meiner, allerdings habe ich den bereits in einer anderen Werkschau besprochen … daher müsst ihr die „Lost in Translation“-Besprechung hier suchen. In meiner Einleitung habe ich gefragt, ob sich Sofia Coppola mit ihrem Schaffen von ihrem Vater absetzen kann. Und ich denke, dass die Auswahl der hier besprochenen Filme das ganz deutlich zeigt. Sie setzt Thema über Budget und Indie über Hollywood. Fast alle ihre Filme entmystifizieren Ruhm, Ruf, Ehre und viele handeln von Frauen, die sich aus ihren Rollen hinauswagen. Ähnlich wie auch sie eine Frau ist, die eine Rolle bekleidet, die vielen Frauen verwehrt bleibt oder ein steiniger Weg ist. Nämlich als Frau Regie zu führen. Einer der schmerzlichen Punkte, an denen man merkt, dass Hollywood immer noch (oder bis vor Kurzem?) anders tickt. Möchte ich spalten und zu Diskussionen aufrufen, dann würde ich die These in den Raum stellen, dass sie vielleicht ohne ihr Umfeld oder ihre finanzielle Situation nicht so weit gekommen wäre, nicht den Output an Filmen liefern könnte (ist euch schon mal aufgefallen wie wenig Filme weibliche Regisseure im Gegensatz zu männlichen Kollegen bei Studios platziert bekommen? Zählt mal die Filme in der Filmografie weiblicher Regisseure.) oder gar nicht die Möglichkeit hätte sich frei für Indie-Settings zu entscheiden oder zu sagen „Nein, aufgrund kreativer Differenzen mache ich nicht den „Kleine-Meerjungfrau“-Film.“ Wie seht ihr das? Aber egal wie ihr oder ich oder irgendjemand das sieht, ihr Schaffenswerk steht für sich und das bedeutet für kraftvolle Dramen, entlarvende aber stille Charakter- und Gesellschaftsstudien und manchmal einfach nur für die Emotionen, die Hollywood-unlike sind und sich deswegen so wunderbar normal und bekannt anfühlen. Melancholisch, launisch und extrem gut fotografiert. Da ihre Charaktere zeigen wie sie sich fühlen, aber selten in Worten ausdrücken, müssen wir viel interpretieren. Und das ist sicherlich manchmal Trumpf, manchmal Bürde, was die gemischten Reaktionen auf manche ihrer Filme zeigt.
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
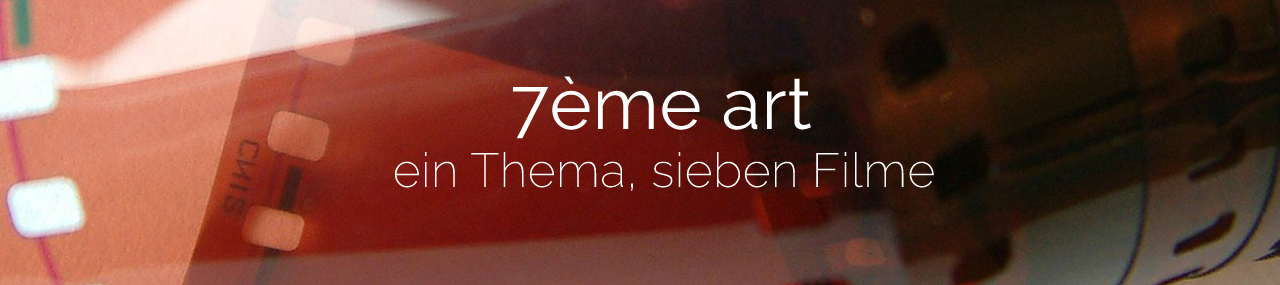
Schreibe einen Kommentar