Im März jährt sich unser neues Normal das erste Mal. Ab März 2020 begannen die Mundschutzpflicht, Lockdowns, Ladenschließungen, Home-Office-Regelungen und irgendwann auch das Home-Schooling. Das Brachliegen des kulturellen Lebens, das Einschränken der Kontakte, die Schulschließungen, das Wegfallen von Events. Was das nach sich zieht? Das Sterben von Geschäften und kulturellen Einrichtungen? Pleiten und Arbeitslosigkeit? Hoffentlich nicht. Die einen befällt die schnelle Gewöhnung an ein neues Normal, andere ermahnen sich jeden Tag zu Geduld bis wir zum vorherigen Zustand zurückkehren können. Wieder andere befinden sich im Zustand der Leugnung. Und auch die Frage, ob wir trotz Impfstoffen zum vorherigen „Normal“ zurückkehren können oder wollen ist valide. Dicht gedrängte Menschenmassen auf Messen, in Bahnen und in Konzerten – das ist so 2019. Bei all diesen Veränderungen erschien mir Paul Austers dystopisch angehauchtes Im Land der letzten Dinge gnadenlos passend.
„Im allgemeinen halten die Leute sich an den Glauben, dass die Lage, so schlimm sie auch gestern war, gestern besser war als heute. Und die von vorgestern besser als die von gestern. Je weiter man zurückblickt, desto schöner und begehrenswerter erscheint einem die Welt.“
Anna Blume reist in die Stadt um ihren Bruder William zu suchen. Er ist Journalist und wurde von seiner Zeitung für eine Reportage dorthin geschickt. Seitdem hat ihre Familie nie wieder von ihm gehört. Anna befindet sich inzwischen seit einer Weile dort. Wie lange wirklich, wissen wir nicht. Sie schreibt einen einzigen langen Brief an jemanden, der ihr wichtig ist und dem sie wichtig ist. Jemand, der nicht wollte, dass sie geht. Der Briefroman beginnt schonungslos mit einer Menge Schilderungen aus dem Leben in der Stadt. Es gibt keine Sicherheiten mehr. Wohnungen werden geplündert, Leute auf der Straße bestohlen. Mieten, Verbindlichkeiten – alles nichtig. Heute wohnst du irgendwo, morgen kommt jemand, bedroht dich und du gehst freiwillig und bist obdachlos. Die Regierung wechselt öfter. Post? Nachrichten? Fehlanzeige.

Dabei wirkt der Beginn des Buches weitaus abschreckender als spätere Kapitel. Anna berichtet in relativ nüchternem Ton von Sekten, die als die Lächler bezeichnet werden. Von Menschen, die auf surreale und abstruse weise Selbstmord begehen, in dem sie beispielsweise bis zur Erschöpfung laufen. Das alles zeichnet das Bild einer Dystopie und einer Protagonistin, die sich damit abgefunden hat. Wie lange hat Anna dafür gebraucht? Oder zwingt uns unser Überlebensinstinkt uns schneller an etwas zu gewöhnen als wir es für möglich halten? Wir erfahren nicht wie die Stadt in diesen Zustand gekommen ist. Wir erfahren auch nicht, welche Stadt das ist. Es wird eine Nationalbibliothek erwähnt und eine Universität. Die Stadt scheint nicht weit weg vom Meer zu liegen. Man baut wohl auch irgendwo einen Damm. Es werden Straßen und Plätze genannt, zu denen die gängigen Suchmaschinen nichts finden konnten. Es werden welche genannt, die man lose irgendwohin einordnen kann wie die Miro Avenue nach Mountain View, Kalifornien. Vermutlich ist die Stadt aber eine Metapher darauf wie schnell das Leben, das wir kannten, verschwinden kann.
„Dies sind die letzten Dinge, schrieb sie. Eins nach dem anderen verschwinden sie und kommen nie zurück. Ich kann dir erzählen von denen, die ich gesehen habe, von denen, die es nicht mehr gibt, doch kaum wird Zeit dafür sein. Es geschieht jetzt alles zu schnell, und ich kann nicht mithalten. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Du hast nichts davon gesehen, und selbst der Versuch, es dir vorzustellen, wäre vergeblich. Dies sind die letzten Dinge. An einem Tag ist ein Haus noch da, am nächsten ist es weg. Gestern ging man über eine Straße, die heute nicht mehr existiert.“ p.9 (Buchbeginn)
Verschwinden und vergessen sind zentrale Motive. Und vielleicht auch ein Überlebensmechanismus. Anna denkt oft an Ausschnitte aus einem sorgloseren Leben zurück, in dem sie sogar regelrecht privilegiert aufgewachsen ist. Aber sie scheint nicht mehr daran zu hängen. Sie umtreibt mehr die Frage wie sie den Winter überleben soll. Rationale Leser, die sich nicht gerne auf große Metaphern einlassen, stellen unweigerlich die Frage nach dem Entkommen. Dafür findet Paul Auster klare Worte. Man ist zu hungrig, zu kraftlos, zu machtlos. Findet vielleicht keine Hilfe, vielleicht keinen Mut. Oder der Winter ist zu krass. Es gibt kein Entkommen aus der Stadt. Flugzeuge und Schiffe kennt keiner mehr, von Autos redet niemand. Alles verschwindet, vor Allem die Optionen. Das Verschwinden macht auch vor Menschen nicht halt:
„Jeder Jude, sagt er, glaubt der letzten Generation der Juden anzugehören.“ p.135
Womit Paul Auster noch an Verbrecher an der Menschheit erinnert und viele „vielleichts“ und Geschichte mischt. Im Land der letzten Dinge ist eine große Metapher darauf wie schnell sich Umstände zu etwas auftürmen können, das wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Kriege, Umstürze – ich muss an die Bilder und Reportagen aus der Ost-Ukraine und Syrien denken. Orte, an denen die Menschen in einem immer weiter voranschreitenden Zustand von Unruhen, Unsicherheit und Mangel leben. Ich muss auch darüber nachdenken wie sich wohl meine Eltern fühlten als der Staat (die DDR), in dem Sie aufwuchsen plötzlich nicht mehr da war und sie sich sicherlich fragten: was kommt jetzt? All die Unsicherheiten, trotz derer wir weitermachen. Das soll keine Verharmlosung unserer jetzigen Umstände sein. Das soll nicht das drohende Sterben der Geschäfte verharmlosen oder die Angst vor dem Ruin Kulturschaffender. Es ist ein dystopischer Roman mit einer dystopischen Metapher für etwas, das alle diese Szenarien auf drastische Weise zuspitzt: Die Veränderung und den Wegfall all dessen, was wir kennen -egal in welchen Schattierungen. Aber die Hoffnung stirbt auch hier nicht. Anna lernt Menschen kennen, die ihr Liebe schenken, die sie aufnehmen, die ihr helfen. Ob Annas Brief jemals angekommen ist, wissen wir nicht. Was wir in Annas Briefen lesen ist der nüchterne Schmerz über das Abhandensein von allem was mal war. Aber auch dass es weitergeht.
„Es dauert lange bis eine Welt verschwindet, viel länger, als man meinen sollte.“ p.40

Fazit
Eine gute Wahl für unsere Zeit, aber auch eine etwas schmerzhafte.
Besprochene Ausgabe: ISBN 978-3-499-13043-4, Rohwolt Taschenbuch Verlag
„ausgelesen“ ist eine Kategorie meines Blogs, in der ich immer zwischen dem 15. und 20. eines jeden Monats ein Buch unter die Lupe nehme. Der Begriff „ausgelesen“ ist sehr dehnbar. So wie die Themenvielfalt meines Blogs. Ein „Buch unter die Lupe nehmen“ schließt Belletristik, Sachbücher, Manga, Comics unvm mit ein. 🙂
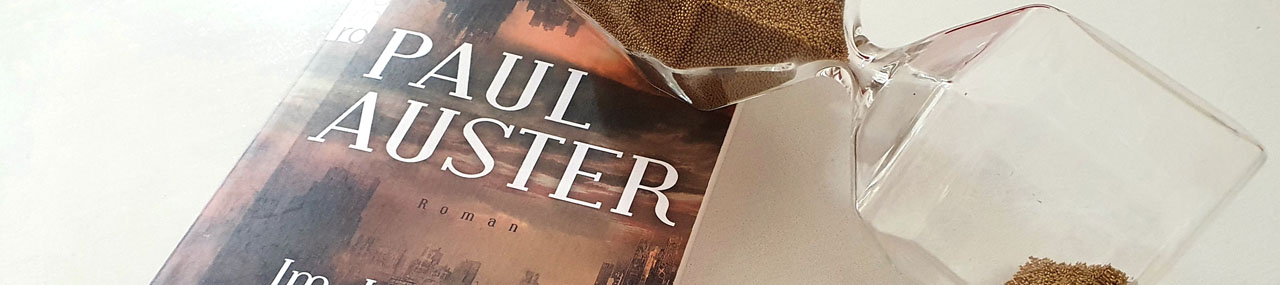
Schreibe einen Kommentar