Der Russische Herbst feiert heute seine zehnte Ausgabe. 🙂 Und Herbst ist natürlich schon lange nicht mehr … ursprünglich war die Auseinandersetzung mit russischer und ukrainischer Literatur, Filmen und Kultur darauf ausgelegt den Herbst und Winter nicht zu überschreiten. In der Zwischenzeit haben sich aber einige Bücher dazugeschmuggelt, die nicht in der angekündigten Leseliste standen, aber so gut zum „Russischen Herbst“ passten. So auch Sorokins „Schneestrum“, eine Empfehlung, die ich gern angenommen und und gelesen habe, als es Anfang des Jahres tatsächlich mal schneite und bitter kalt war. Und ähnlich den Protagonisten gingen das Buch und ich tatsächlich auch auf Reisen.

Dieser verdammte Schneesturm
Der Landarzt Platon Iljitsch Garin muss dringend in ein entlegenes Dorf, um die dortige Bevölkerung zu impfen. Eine Epidemie wurde in Russland eingeschleppt. Sein Vorhaben wird nicht leichter, da ein heftiger Schneesturm tobt. Er bekommt den Tipp sich an den Kutscher Kosma zu wenden, der einen Schlitten mit Gespann hat. Garin heuert ihn und sein Gespann aus Zwergpferdchen an, nennt ihn wegen seiner Stimme und seinem seltsamen Lachen den „Krächz“. Dabei wird der Sturm immer schlimmer, die Not immer größer. Und der Leser fragt sich bald …
Wann bin ich?
Anfangs mutet die Geschichte wie aus einem vergangenen Jahrhundert an. Man liest von dem Landarzt, Öfen in engen Stuben, armer Bevölkerung und Pferdegespann und hat ein fertiges Bild im Kopf. Man wähnt sich fast in Dostojewski- oder Tolstoi-esquen Geschichten, mal abgesehen von der nicht im mindesten schwülstigen oder altertümlichen Sprache. Malt sich eine entsprechende Vorstellung vom Krächz und Garin. Aber dann beginnen die Zweifel als die Reise der Beiden fast zu einem Ende kommt, weil etwas unter der Schneedecke die Kufen des Schlittens gespalten hat. Etwas extrem hartes, geometrisches Etwas, das mitten im Weg lag. So hart, dass es Kufen spaltet? Was kann das sein? Sie müssen einen Zwischenstopp einlegen. Und dann kommen mehr dezente Hinweise.
„Der Doktor trat in ein geräumiges, nach hiesigen Maßstäben reich und solide ausgestattetes Bauernhaus. Zwei große Petroleumlampen erleuchteten den Raum. Als da waren: zwei Öfen, […] zwei Tische, […] Truhen, Bänke, Regale mit Geschirr, in der Ecke das Bett; der Radioempfänger, mit gehäkeltem Deckchen darauf; das Porträt des Gossudaren im uanuslöschlichen regenbogenschillernden Rahmen, die Porträts der Gossudarentöchter Anna und Xenia ebenso gerahmt, eine doppelläufige Flinte und eine Kalaschnikow am Rentiergeweih hängend […].“ p. 46 ff
Eben liest man noch vom Gossudaren („Herrscher, Zar, Herr“) und Häkeldeckchen und im nächsten Moment von der Kalaschnikow. Da stellt sich Anlass ein, um jetzt wirklich stutzig zu werden. Spätestens, wenn der Radioempfänger sich als ein Radio mit Hologramm-Ausgabe outet und einem Spielzeug, das den Song „Love me tender“ spielen kann, ist klar, dass der Roman eigentlich in der Zukunft spielt. Als dann auch noch der Charakter der grausamen Epidemie klar wird, wandelt sich Sorokins altertümlich beginnende Geschichte zu einer Dystopie. Und das ist das vielleicht charakteristischste und überraschende an dem Buch. Das Spiel mit den Erwartungen des Lesers.
Meine Pferdis und ich
Die Reise Garins und des Krächz ist eine obskure. Beginnend bei dem zwiespältigen Garin, der beschrieben wird als ein „großer, kräftiger zweiundvierzigjähriger Mann mit einem steten Ausdruck konzentrierter Unzufriedenheit im schmalen, sorgfältig glatt rasierten Gesicht.“ (p. 9). Garin ist ambitioniert, aber korrumpiert, schlecht gelaunt, war im Herzen wohl mal ein guter und will ja wirklich versuchen dieses Dorf zu erreichen und die Leute zu impfen. Aber er ist kein schweres Leben oder einfache Leute gewöhnt. Die Härte des Schneesturms tut sein Übriges und er wird nicht selten zum Ekel, das seine Ideale vergisst. Man muss ihm zugestehen: ich würde bei so einem Schneesturm auch nicht auf einem Schlitten sitzen wollen. Der „Krächz“ hingegen ist ein einfacher Mann, aber ein gutherziger. Seinen „Pferdis“ darf niemand etwas tun. Er nimmt die Beschwerlichkeit der Reise und die widrigen Umstände stets hin und versucht das Beste daraus zu machen. Aber seine Welt geht auch nicht unter, wenn sie das Dorf nicht schnellstmöglich erreichen. Die beiden könnten kaum unterschiedlicher sein. Und zwischen reich und arm scheint es auch insgesamt wenig Schattierungen in der Geschichte zu geben. Und letzten Endes kann wohl der eine nicht ohne den anderen. Aber der andere ohne den einen möglicherweise schon … .
„‚Wo das Dorf ist, will ich wissen!‘, brüllte der Doktor und hasste in diesem Moment alles: den Schneesturm, den Friedhof, den Krächz, diesen Knallkopf, der ihn sonst wohin kutschierte, die nassen, frierenden Zehen, den schweren Parka mit dem anhaftenden Schnee, das bescheuerte Mobil mit der bescheuert bemalten Lehne und den bescheuerten Zwergpferdchen in der bescheuerten Sperrholzklaube, die erfluchte Epidemie, […]“ p. 95 (das geht noch so eine Weile weiter, Garin hasst halt alles in diesem Moment)
Die Reise beginnt, ist zuweilen obskur und endet abrupt. Und schockiert zwischendurch. Zwischen Zwergpferdis und den Gastgebern bei denen Garin und der Krächz kurz unterkommen, gibt es einige Szenen, die den Leser befremden und gewollt skurril sind. In dem Obskuren liegt eine Parabel auf das Russland vergangener Zeiten und eventuell auch künftiger. Gleichgültigkeit, Versorgungsnot, Krankheit, autonome und gewalttätige Gruppen. Die Geschichte wiederholt sich. Und die Gegenwart des Romans ist eine frostige – vielleicht so ähnlich wie der andauernde, starre Winter der russischen Gesellschaft. Ob mit oder ohne Drogen, schwere Mäntel, Schneestürme und Schlittenfahrten. Sorokin steht als Polit-Kritiker oftmals selber unter Beschuss. Der Schneesturm ist vielleicht sein leisester und weniger systemkritischer Roman, aber damit auch der zugänglichste und angenehm überraschendste, wenn man sich auf die Obskuritäten der beschwerlichen Reise einlassen kann. Gemessen an der am meisten zum Fremdschämen angelegten Sexszene, die ich jemals gelesen habe.
Bisherige Artikel der Beitragsreihe
I: Ankündigung
II: Sachbuch-Besprechung zu „Russische Geschichte“ von Andreas Kappeler
III: Hörbuch-Besprechungen zu Sergei Lukjanenkos Wächter-Reihe Band 1 „Wächter der Nacht“
IV: Fjodor Dostojewskij „Der Spieler“
V: Natascha Wodin „Sie kam aus Mariupol“
VI: Michail Bulgakow „Der Meister und Margarita“
VII: Serhij Zhadan „Internat“
VIII: Serien-Besprechung „The Romanoffs“
IX: Film-Besprechung „Stalker“ (Andrei Tarkowski)
Header image photo credit: Vyacheslav Argenberg
Das Buch hat mir richtig Spaß gemacht 😀 Und obwohl der russische Herbst sich durch diverse Bücherempfehlungen um einiges verlängert hat, bin ich sehr froh Sorokin entdeckt zu haben – an der Stelle danke für den Tipp. Besonders sticht für mich das Talent Sorokins heraus Satire und Kritik so in den Text und die Handlung zu verpacken, das es einem nicht mal richtig ins Auge springt, sondern immer wieder sachte den leisen Verdacht schürt. Der Kniff mit der Vergangenheit und Gegenwart macht das knapp 200-Seiten-Buch zu einer Überraschung. Mit dem Grundsetting und Obskurität muss man sich aber wie gesagt anfreunden können. Habt ihr schon was von Sorokin gelesen? Habt ihr weitere Empfehlungen für mich? Sein wohl neuester „Manaraga“ steht schon auf meiner Liste, genauso wie „Der Tag des Opritschniks“.
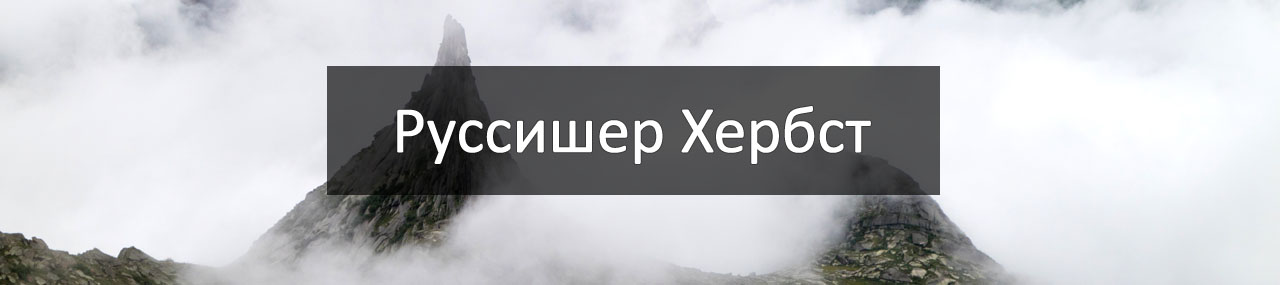
Schreibe einen Kommentar