Als ich mich das erste Mal mit der Nouvelle Vague beschäftigte, war das auch meine erste Begegnung mit Agnès Varda. Wenn ich manchmal Probleme habe für 7ème art Regisseurinnen zu finden, dann ist das für mich meist Indiz des tiefsitzenden Problems dem sich Frauen in der Filmindustrie gegenübersehen. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele, die mehr als sieben Engagements in ihrer Filmografie aufweisen. Absolut faszinierend, dass Agnès Varda dieses Problem definitiv nicht hatte. Im Gegenteil, sie gilt als Wegbereiterin der „französischen neuen Welle“. Das und Vardas Esprit versprühende Interviews sind mir mehr als genug Anlass um mich endlich mal gründlicher ihren Werken zu widmen. Also heute: sieben Filme der Regisseurin Agnès Varda.
La Pointe Courte
Ein Mann (Philippe Noiret) und seine Frau (Silvia Monfort) treffen sich in La Pointe Courte, seiner Heimat. Er war sich nicht sicher, ob sie kommt und ging jeden Tag zum Bahnhof. Kaum, dass sie da ist, eröffnet sie ihm, dass sie sich trennen will. Während die Beiden erörtern, wo es für sie hingehen soll, schreitet das Leben der Menschen im Örtchen voran. Die Fischer bangen um ihre Existenz, Feste werden gefeiert, der Alltag ist mehr als präsent. Hier wird Wäsche aufgehangen, da gearbeitet. Beides komplimentiert sich auf seltsame Weise.
La Pointe Courte atmet eine ähnliche Atmosphäre wie ich es auch Terrence Malicks Filmen zuschreiben wird. Kino, das man erspüren muss. Die hochgestochenen Dialoge des Paares sind ein krasser Gegensatz zu den alltäglichen Sorgen der Leute von La Pointe Courte, haben aber vielleicht eine positive Wirkung. Vielleicht sind es gerade sie, die das Pärchen wieder erden. Auf jeden Fall lassen sie irgendwann über das Paar den Satz fallen „Sie reden zuviel um glücklich zu sein“ und damit haben sie vielleicht recht. Beide gegensätzliche Geschichten werden begleitet von Bildern der Fischerei und ländlichen Gegend. In punkto Metapher und Bildsprache ein Lehrstück, das Vardas Fotografinnenkarriere offenlegt. Wenn das Paar streitet, dann werden sie schon mal von Bahngleisen getrennt und den tösenden Geräuschen des Waggons darauf. Disharmonie in Bild und Ton. Wenn das Trennungsgespräch von dem Anschwämmen eines Katzenkadavars begleitet wird, dann ist das schon fast etwas zuviel Symbolismus. La Pointe Courte ist als Kunstfilm sicherlich nicht für alle oder jeden Tag etwas, aber ein faszinierendes Symbolkino, in dem man mit Leichtigkeit erkennt wie es half Nouvelle Vague aus der Taufe zu heben. Selbstvergessen dreht sich daa Paar im Kreis während das Leben des Fischersorfs um sie herum weitergeht. That’s life!?
La Pointe Courte, Frankreich, 1955, Agnès Varda, 80 min, (7/10)

Le Bonheur (1965) Trailer, Vlad Babei, Youtube
Das Glück aus dem Blickwinkel des Mannes
Der deutsche Titel ist sogar ausnahmsweise mal etwas mehr in your face als der Originale. Vardas Le bonheur („Das Glück“) handelt vom Tischler und Familienvater François (Jean-Claude Drouot), der eigentlich in seiner Ehe vollkommen glücklich ist. Als er aber die Postangestellte Émilie (Marie-France Boyer) trifft, ist es trotzdem um ihn geschehen. Zuhause Familienglück mit seiner sanften Ehefrau Thérèse (Claire Drouot), parallel Leidenschaft teilen mit der anderen. Beides haben, geht das!? Der Film zeichnet Bilderbuchbilder eines Ideals so wie sich das François sicherlich wünschen würde. Ob das Realität sein kann, liegt im Auge der Betrachtenden.
Tatsächlich gibt Varda keinen Hinweis darauf, ob all das parallele Glück nur ein Traum ist. Wir müssen annehmen, dass all das wirklich so für François geschieht. Als es ein Unglück gibt, wissen wir aber nicht, wieviel davon an dem Unglück schuld ist. Ab da gibt es eine nagende Ungewissheit hinter den schönen Bildern. Man kann den Film so dahinplätschern lassen ohne das zu hinterfragen und es gerissen finden, dass der Titel so gewählt ist. Wenn man es nicht hinplätschern lässt, sucht man zwangsläufig Gründe für das Gesehene. Indizien, dass das Geschehene unfair ist und dass es die Personen innerlich zerreißen müsste. Was nicht geschieht. Denn es gehört immer noch zu der Vorstellung reinen Glücks, in der Schuldfragen keinen Platz haben. Vielleicht ist daher meine Kritik an dem Film, dass er uns zu wenig an die Hand nimmt und zu wenig vorgibt, ob wir es dahinplätschern lassen sollen oder doch nochmal darüber nachdenken. Das Flair aus Familienglück und Flirt ist greifbar, die Jahreszeiten schmeckbar und die intimen Bilder sind betörend. Optisch und atmosphärisch ein Lehrstück, mit einem unleugbaren 60er Jahre Flair.
Das Glück aus dem Blickwinkel des Mannes (OT: Le bonheur), Frankreich, 1965, Agnès Varda, 80 min, (6/10)

Die Geschöpfe
In der Eröffnungssequenz warnt Mylène (Catherine Deneuve) ihren Mann Edgar (Michel Piccoli) nicht zu schnell zu fahren. Trotzdem tut er es, das würde ihm Inspiration bringen. Danach schrieben sich seine Bücher wie von selbst. Trotzdem baut er einen Unfall, der ihm eine große Narbe einbringt und Mylène die Stimme kostet. Beide sind glücklich, aber der Unfall wie der Anfang einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung in der Opfer für die Berufung gebracht werden. Edgar ist Autor und schreibt an einem Science-Fiction-Roman, in dem es u.a. um fremdgesteuertes Handeln geht. Als die Bewohner:innen ihrer Kleinstadt beginnen sich feindseelig und seltsam zu verhalten, verwischen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion.
Es gibt eine ganze Menge, was in dem Film nur unscharf umrissen ist. War schon Edgars anfänglicher Unfall ein fremdgesteuerter Akt? Dann funktioniert die Theorie nicht, dass er und sein Roman das Geschehen beeinflussen. Varda nutzt als Signal für die Fremdsteuerung rote bis pinke Überblenden über dem Schwarzweißfilm. Und Rot sehen ist hier die perfekte Metapher. Spätestens, wenn der Autor und seine Figur (oder doch ein echter Mensch!?) sich duellieren, indem sie die Dorfbewohner:innen über ein Schachbrett schicken, wird es stellenweise ganz schön brutal. Wo man nun die Charaktere des Dorfes alles kennengelernt hat, ist es alles andere als ein feiner Zug zu sehen wie sie einander betrügen oder Gewalt antun. Hier ist etwas aushalten angebracht. Auch wenn das Gedankenspiel eben auch sehr spannend ist. Ist die Brutalität in der Fiktion und im Kopf des Autors nicht am Ende des Tages eben auch Brutalität?
Die Geschöpfe (OT: Les Créatures), Frankreich/Schweden, 1966, Agnès Varda, 92 min, (6/10)

Agnès Varda’s Vagabond – clip | BFI, Youtube
Vogelfrei
War pseudodokumentarisch jemals so ehrlich? Mit ungeschöntem Blick erzählt Agnès Varda hier nach eigenem Skript von der jungen Landstreicherin, die sich selber Mona (Sandrine Bonnaire) nennt. Dass Mona schon von Anfang an ein Mythos ist, liegt wohl v.A. auch daran, dass Vogelfrei recht antiklimaktisch mit ihrem Tod beginnt. Man könnte nun annehmen, dass der Film dadurch wenig an Spannungspotential zu bieten hat. Doch ist da aber die quälende Frage: wie ist Mona da hingekommen?
Varda erzählt ab da im Rückblick und überrascht umso mehr, wenn Mona zuerst selbstbewusst, nicht auf den Mund gefallen, wehrhaft, manchmal rotzig und so wahnsinnig frei wirkt. Im Film wird neben ihrer Reise ohne Dach und ohne Gesetz (so in etwa würde auch der Originaltitel übersetzt werden) gezeigt wie Mona die Menschen beeinflusst, denen sie begegnet. Gerade Frauen sehen sie an und bekommen entweder das Gefühl ihr helfen zu wollen oder beneiden sie um ihre Freiheit. Männer haben teilweise Angst von ihr, manche fühlen sich zu ihr hingezogen. Aber hey, natürlich nur solange sie nicht schmutzig ist. Weil, natürlich bewundern wir Freiheit und die Entscheidung sich gegen alle ungeschrieben Regeln zu stellen, aber Schmutz mögen wir nicht, nein. Während Mona dann eine Zeit lang als eine Art Sinnbild von Freiheit auftritt, glorifiziert Varda ihr Aussteigertum aber auch nicht. Sie zeigt falsches Helfersyndrom genauso wie die Gefahren, wenn man auf der Straße lebt. Und ohne zu werten. Dabei finde ich auch gerade das Ende besonders wichtig, weil es leider besonders erschreckend ist. Es ist eben sehr leicht zu sagen „so möchte ich auch sein“ ohne sich die Konsequenzen präsent zu machen.
Vogelfrei (OT: Sans toit ni loi), Frankreich, 1985, Agnès Varda, 100 min, (8/10)

Die Zeit mit Julien
Das ist dann wohl mein erster Film mit Jane Birkin. Sie spielt die 40-jährige, zweifache Mutter Mary-Jane, die sich in einen 14-jährigen Jungen verliebt. Lucien (Mathieu Demy) ist ein Klassenkamerad ihrer Tochter Lucy (Charlotte Gainsbourg). Er ist kleiner als gleichaltrige Jungs, dafür aber etwas quirliger, clever und nicht auf den Mund gefallen. Anfangs rührt er etwas mütterliches in Mary-Jane, sie laufen sich öfter über den Weg. Sie findet nicht viel an dem Gedanken, dass der Junge ihr nicht aus dem Kopf geht; forciert aber auch nichts. Dass es kompliziert wird ist unvermeidlich. Denn auch Lucien sucht die Nähe der über 20 Jahre älteren Frau.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich in Mary-Janes Gefühle ganz verschiedene mischen. Da mag ein Teil mütterlicher Fürsorge sein, vielleicht auch Anziehung, vielleicht auch Schmeichelei, weil sie jemandem auffällt. Sie ist sich dessen vollkommen bewusst wie auch des besonderen Schutzes, der Kindern gebührt. Durch den inneren Monolog Mary-Janes, mit dem sie das Geschehen und ihre Gefühlswelt kommentiert, erfahren wir, dass ihr das alles nicht einerlei ist. Von außen wird das Geschehen auch durch die allgemeine Sorge (und Mythen) über AIDS kommentiert anhand von zig Aufklärungs-Kampagnen und Schulhofgesprächen. In Erinnerung bleibt der Film auch durch die Öffnungssequenz in der Julien wie die Videospielfigur seines Lieblingsspiels im Karate-Dress die Straße runterläuft. Vielleicht ist es für Julien alles ein Spiel – zumindest zu Anfang und zum Ende. Für Mary-Jane ist es eins mit Konsequenzen. Der Film kommentiert das nicht und erlaubt es das Geschehen wertungsfrei zu betrachten und uns in die nostalgische Gefühlswelt aus Abtasten moralischer Grauzonen, Sexualität und dem Bedürfnis nach Nähe abzutauchen. Der Film handelt gleichermaßen von Coming-of-Age wie auch Altern, von Mutter-Tochter-Beziehungen wie abwesenden Eltern.
Die Zeit mit Julien (OT: Kung-fu master!), Frankreich, 1988, Agnès Varda, 80 min, (9/10)

KUNG-FU MASTER! – OFFICIAL TRAILER, Cinelicious Pics, Youtube
Die Sammler und die Sammlerin
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal einen Film über Nachlese so spannend finden würde, also des Sammelns der Reste auf den Feldern nach der Ernste. In Die Sammler und die Sammlerin zieht Agnès Varda halb dokumentarisch, halb erzählend einen Bezug zwischen der Nachlese auf den Feldern wie in Gemälden früherer Jahrhunderte und heutigem Dumpster Diving („containern“). Sie reist durch Frankreich und beobachtet, wo diese Nachlese erlaubt ist, wo nicht. Manchmal steht dort zwischen Grünkohl und Tomaten gar ein Jurist im Feld, der uns erklärt, wann was erlaubt ist. All die gezeigten einzelnen Geschichten und Reportagen sind ein Bild menschlichen Konsums, Verbrauchs und mangelnden Bewusstseins im Umgang mit Lebensmitteln und Eigentum. X elektrische Geräte und Möbel, die am Straßenrand enden, sind nur ein Zeugnis davon wie auch die Massen an noch guten Lebensmitteln, die im Müll landen. Varda sieht sich dabei als Sammlerin von Geschichten und Informationen. Sie kokettiert mit ihrer Digitalkamera und zeigt den ungeschönten Blick auf die Zeit, die wir alle sammeln und die an unseren Körpern sichtbar ist.
Die Sammler und die Sammlerin (OT: Les glaneurs et la glaneuse), Frankreich, 2000, Agnès Varda, 82 min, (8/10)

Varda par Agnès
Agnès Varda verstarb 2019. Kinostart ihres Dokumentarfilms Varda par Agnès über ihr Schaffens war 2020, während er 2019 noch im Zuge der Berlinale lief. Wieviel hat sie an dem Film noch mitgearbeitet? Vielleicht nicht soviel wie sie wollte – dazu fand ich leider wenige Quellenangaben. Dass sie aber bis kurz vor ihrem Tod gearbeitet hat und daran gearbeitet hat, ist offensichtlich. Das ist Varda. Varda hat immer gearbeitet, geschaffen und inspiriert. Das beweist gerade dieser Film. Macht ein Filmschaffender einen über sich selbst, könnte das prätentiös sein oder magisch verklärt, ich habe mit den Fabelmans gehadert und ich denke ich möchte nie einen Film über Quentin Tarantinos Werdegang sehen. Manche Dinge können nicht gut werden. Varda par Agnès (also „Varda über Agnès“) setzt aber schon mit dem Titel den Standard in sympathischer Auseinandersetzung mit dem Selbst, dem Schaffen, Erfolgen und Misserfolgen. Nicht straff chronologisch, sondern mehr in ihre Schaffensphasen untertitelt, schneidet der Film diverse Interviews, Panels oder extra gedrehte kurze Features über die Etappen in Folge.
So erleben wir rückblickend Agnès Vardas Zeit als Regisseurin. Manchmal seziert sie mit einem Publikum Szenen aus ihren Klassikern wie Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7, manchmal sitzt sie mit ihren Darsteller:innen wie Sandrine Bonnaire aus Vogelfrei auf einer Wiese und redet über die speziellen Kamerafahrten des Films und welche Szene die größte Herausforderung für sie beide war. Zwischen diesen an eine Master Class oder an eine (lockere) Vorlesung erinnernde Etappen wird Varda sehr persönlich, denn das sind auch einige ihrer Filme wie der über ihren verstorbenen Mann Jacques Demy oder der Dokumentarfilm Die Witwen von Noirmoutier. Genauso widmet sich der Film aber auch in kleinen Passagen der Schwierigkeit Finanzierung zu finden, dem Gewinnen von Preisen und warum es das Finanzieren trotzdem nicht einfach macht. Dem Film, den alle kennen und den Filmen, die wenige kennen. Was auch wenige kennen: ihr Werk als Fotografin und ihre späteren Installationen. Wow, sie kann.
Varda par Agnès, Frankreich, 2019, Agnès Varda, 116 min, (9/10)

VARDA BY AGNÈS Trailer | TIFF 2019, TIFF Trailers, Youtube
Leistet man sich nicht gerade eine DVD-Box, dann ist es leider nicht gerade einfach Agnès Vardas Filme zu finden und zu schauen. Viele Streaminganbieter konzentrieren sich eben leider nur auf neu, größer, bunter, lauter. Aber immerhin: gerade als ich meine Werkschau beginnen wollte, waren zig Filme Vardas auf MUBI verfügbar, leider einige davon nur noch wenige Tage. Das war eine sehr plötzlich, sehr intensive Werkschau. ^^ Einige davon sind übrigens noch immer verfügbar wie beispielsweise „Die Sammler und die Sammlerin“. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, falls ihr euch fragt.
In dieser Zeit habe ich viele Dinge an Vardas Filmen das erste Mal wahrgenommen, beispielsweise wie „lokal“ sie sind. Man sieht so viele verschiedene Landschaften Frankreichs. Ganz anders als das, was ich derzeit oft im Kino sehe, entwickeln sie ein lebensnahes Gefühl und eine ganz andere Greifbarkeit. Und dass obwohl sie oftmals mit schön fotografierten, künstlerischen Experimenten spielen wie den Blumen, Farb-Standbildern und Szenen der Liebenden im schwer zu entziffernden „Das Glück aus dem Blickwinkel des Mannes“. Sie hat so oft weibliche Protagonistinnen und Blickwinkel in all den Jahren. Alleine diese Werkschau umspannt Filme von 1955 bis 2019. Über 50 Jahre Film – dabei hat Varda noch soviele mehr gemacht. Betrachte ich das, wirkt es als ob die Filmbranche auf dem Weg in die 2000er Rückschritte gemacht hätte. Vielleicht ändert sich das. Vor Allem macht es mir aber bewusst wie sehr wir Regisseurinnen brauchen und wie sehr die Regisseurinnen unserer Zeit Engagements und Freiräume verdienen.
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
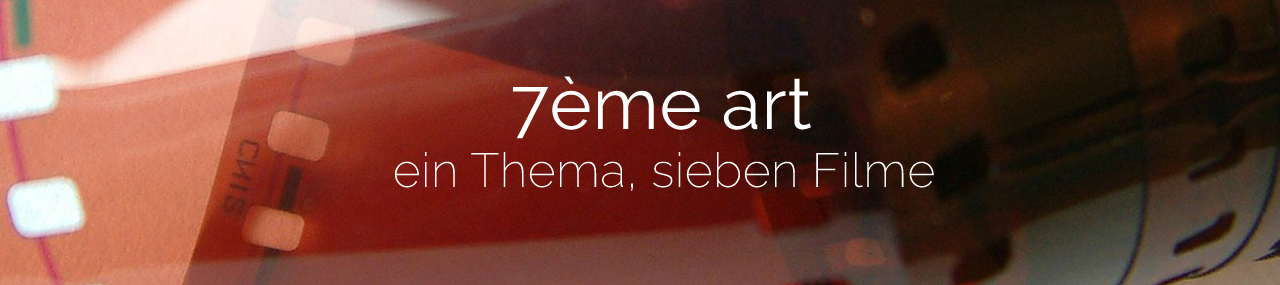
Schreibe einen Kommentar