Es war in Bernardo Bertoluccis Die Träumer, als mir quasi die Idee eingeimpft wurde mich mit der Bewegung des Nouvelle Vague zu beschäftigen. Die Namen einiger der treibenden Kräfte dieser Filmströmung hat man schon mal gehört: allen voran François Truffaut und Jean-Luc Godard. Auch die Protagonisten in „Die Träumer“ schwelgen den Zeiten des dort abgebildeten Kinos hinterher. Sie spielen Szenen aus „Die Außenseiterbande“ nach und haben zueinander eine ähnlich schwierige amouröse Beziehung. Die heute hier besprochenen sieben Filme (okay, … zumindest sechs davon) gehören der Filmbewegung des Nouvelle Vague (frz. „Neue Welle“) an. Einer Strömung, die etwa ab den 1960er Jahren existierte und das Leben natürlich einfangen wollte. D.h. nicht mi gestelzter und für den Film gezierter Art wie Schauspieler sich beispielsweise in Hitchcocks Filmen geben. Nichts gegen Hitch, aber soviel müssen wir zugeben: sehr natürlich wird das Leben dort nicht abgebildet und ebenso wenig verhalten sich die Figuren natürlich.
Dadurch entstand unbeabsichtigt der Begriff des Autorenkinos und slice-of-life-artige Themen wurden interessant – und vor Allem interessant dargestellt. Denn durch die Verwendung frischer Montage- und Überblendtechniken wirkte Nouvelle Vague anders als das bisher dagewesene, zuweilen sogar künstlerischer als vielleicht beabsichtigt. Die Drehweise war dank der Erfindung der Handkamera locker und leicht, aktiv und agil. Es entstand die sogenannte „Neue Welle“ eines unbeschwerteren gefilmten Kinofilms, der sich introspektiver und zeitgenössischer Themen annimmt. Die Helden sind einfache Leute, die Träumen mit verheerenden Folgen hinterhängen oder über Beziehungen sinnieren. Werfen wir mal einen Blick drauf.
„Breaking The Rules – The French New Wave | CRISWELL | Cinema Cartography“, via Criswell (Youtube)
Sie küßten und sie schlugen ihn
François Truffauts Film gilt als Beginn der Nouvelle Vague, war dabei sein erster längerer Spielfilm. Die ikonische Endszene ist oft kopiert. Der Titel im deutschen Verleih ist vielleicht nicht sehr weit hergeholt, deckt sich aber nicht mit dem Originaltitel, der soviel bedeutet wie „Vierhundert Streiche“. Und das gibt ganz gut wider wie der Alltag der Hauptfigur in Truffauts Film aussieht. Er handelt von Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), einem Schüler von ca 14 Jahren, der seine Lehrer ganz gut auf Trab hält. Er spielt eine Menge Streiche und denkt sich das eine oder andere aus, um keine Hausaufgaben machen oder zur Schule gehen zu müssen. Während er schwänzt, erlebt er das eine oder andere in Paris mit seinen Freunden. Die Leichtigkeit der Streiche wird sachte durchzogen von Einblicken in das familiäre Leben. Seine Mutter (Claire Maurier) begegnet ihm mit Strenge, er muss viele Aufgaben im Haushalt verrichten und ihm wird wenig zugehört. Später erwischt er seine Mutter beim Fremdgehen, glückliche oder friedvolle Szenen der Familie sind selten. Als sich Antoines Streiche zuspitzen und krasser werden, der Junge stiehlt und raucht, spitzt sich die Lage schnell und konsequent für ihn zu. Einen Jungen, der Ärger macht, den will ja keiner!?
Ähnlich anderen Filmen der Nouvelle Vague wechselt die anfängliche Leichtigkeit zu einem Punkt des Realisierens, dass die Leichtigkeit nur ein schöner Schein war und allzu hart eine bis dahin verdeckte Realität offenbart. So erfährt man in welche Zustände Antoine hineingeboren wurde und wie seine Familiengeschichte begann. Seine Streiche waren schon vorher als ein Schrei nach Aufmerksamkeit entzifferbar, Truffaut geht aber noch weiter und charakterisiert Antoines Rundumschläge als ein Ergebnis der Ignoranz, der vernachlässigten erzieherischen Pflichten und fehlender Liebe. Und als sie der Meinung sind den Jungen nicht mehr unter Kontrolle zu haben, schieben sie ihn auf das Abstellgleis. Ein entlarvender Film, der aber die eine oder andere Länge hat und eine störende Distanz zum Zuschauer aufrecht erhält. Man sieht zwar was los ist, aber Antoines Innenleben bleibt auf einer Armlänge Abstand. Die meiste Nähe hat man wohl gegen Ende des Films zu ihm. Nichstdestotrotz ein Film, der wachrüttelt und empört – wie leicht Menschen andere Menschen aufgeben, denen sie ja eigentlich nie eine Chance gaben. Berührend und lebendig gefilmt. Und der Anfang eines zwanzigjährigen(!) Filmzyklus um die Figur Antoinel Doinel, der dabei durchweg von Jean-Pierre Léaud gespielt wurde. Sowas gab es seitdem nie wieder in der Filmgeschichte. Und: die Figur Doinel ist wohl autobiografisch – Truffauts erlebte ähnliches in seiner Kindheit.
Sie küßten und sie schlugen ihn (OT: Les Quatre Cents Coups), Frankreich, 1959, François Truffaut, 99 min, (8/10)

Hiroshima, mon amour
Man merkt es dem Film an, dass Alain Resnais zuerst plante einen Dokumentarfilm zu machen. Anfangs fühlt sich Hiroshima, mon amour fast wie ein Stream of Consciousness an. Man hört die Stimmen einer Frau und eines Mannes. Wir können sie noch nicht sehen, nur ihre Körper in inniger Umarmung. Sie reden über Hiroshima und die Gräuel des Atombombenabwurfs, der Katastrophe, der Folgen und Unruhen, der zerstörten Leben. Mit den entsprechenden Bildern von Toten, deformierten Menschen, von Krankheit, Leid, vom Friedenspark und dem Friedensdenkmal der Kinder. Dabei sagt die Frau immer wieder, was sie alles im Museum oder Fernsehen gesehen hat und der Mann antwortet: „Du hast nichts gesehen in Hiroshima.“ Damit hat er wohl nicht Unrecht, aber im Laufe des Tages wird er merken, dass auch sie ihr Päckchen zu tragen hat. Sie ist eine französische Schauspielerin (Emmanuelle Riva), er ein japanischer Architekt (Eiji Okada). Beide sind verheiratet und in Hiroshima eigentlich nur auf Dienstreise. Sie fühlen sich zueinander hingezogen. Nach einer gemeinsamen Nacht will er mehr und versucht sie davon zu überzeugen zu bleiben. Heute würde man wohl sagen er stalkt sie. Und fragt sie aus, sie beginnt von Nevers zu erzählen, der französischen Kleinstadt in der sie geboren wurde, sich das erste Mal verliebte, die Auswüchse des Krieges und die Natur der Menschen kennenlernte. In ihr steckt ein tiefes Trauma, das indirekt mit dem Krieg verbunden ist, aber v.A. damit zu was Menschen fähig sind.
Zwar würde der Film den Bechdel-Test nicht bestehen, weil sie nie mit einer anderen Frau redet, und doch ist es ein Film über sie und was Hiroshima mit ihr anstellt. Es weckt Erinnerungen, die sie verdrängt hatte und die ihr innerstes Umstülpen. Kann und will sie den Forderungen des Fremden nachgeben? Will sie mit ihm leben? In Hiroshima, einem Sinnbild dessen, wozu Menschen fähig sind und dass sie stets an ihre Vergangenheit erinnert? Kann sie aber nach dem, was sie erlebt hat, zurückgehen? Dadurch, dass die Rolle und fiebrige Persistenz ihres japanischen Liebhabers etwas einseitig bleibt, bekommt man gegen Ende fast den Eindruck, dass er nur eine innere Stimme ist und gar nicht existiert. Fakt ist in jedem Fall, dass der Film den Gedanken und Emotionen der namenlosen Protagonistin viel Raum gibt. Raum zum trauern, zum Aufarbeiten und gleichzeitig ein glühendes Plädoyer für Pazifismus ist. Ein Antikriegsfilm. Ein Film, der unterstreicht, dass wir alle, egal wo auf der Welt, gleich sind. Nicht nur indem Resnais die Bilder von Originalschauplätzen in Nevers und Hiroshima perfekt nacheinander montiert. Es ist kein leichter Film, kein fröhlicher Film. Hiroshima, mon amour ist manchmal ein bisschen langweilig, ist aber schwelgerisch, schön, einfühlsam, ernst und von einer besonderen filmischen Schönheit trotz seiner Langatmigkeit und teilweise hermetischen Sinnsuche.
Hiroshima, mon amour(OT: Hiroshima mon amour); Frankreich/Japan, 1959, Alain Resnais, 90 min, (8/10)

„JULES & JIM TRAILER“, via Umbrella Entertainment (Youtube)
Jules und Jim
Der Franzose Jim (Henri Serre) und der Österreicher Jules (Oskar Werner) freunden sich an, teilen ihre Gedanken zu Literatur, der Liebe und der Welt und ab und zu teilen sie sich auch mal eine Frau. Als sie aber Catherine (Jeanne Moreau) treffen, ändert sich alles. Nicht mal der Krieg konnte die beiden Männer entzweien und Spoiler: Catherine kann es im Grunde auch nicht, aber die Amour Fou ändert einiges und zeichnet die beiden Männer und ihre Einstellung zum Leben. Während der Film unglaublich beschwingt, temporeichund witzig wie ein Feelgood-Movie beginnt, kippt die Stimmung als die zarten Bande nicht so halten wollen.
Es ist frappierend wie offenherzig die Drei in einem Film, der kurz vor und nach dem ersten Weltkrieg spielt mit dem Thema Beziehung umgehen. Mit einem ähnlichen Tempo wie zu Beginn des Films die Gags anrollten, wechseln sie ihre Partner. man verliert zwischendurch fast den Überblick. Schwarzweißfilme verbinden die wenigstens Menschen mit Tempo, aber Neue Welle macht hier ihrem Namen alle Ehre. die Konzepte sind modern und regen zum diskutieren und nachdenken an. Der intelligente Wortwitz spricht den Zuschauer an, anstatt auf blöde Gags zu setzen. Man versteht schnell, was mit Autorenkino gemeint ist. Hier steckt der Witz zwischen den Zeilen und manchmal in den Bildern. So wenn beispielswise Jules mit einer riesengroßen Sanduhr rumläuft, die ihm sagt, wann er ins Bett muss. Umso mehr bedrückt es wie die unterschiedlichen Bedürfnisse der Drei sie letzten Endes in das Verderben stürzen. Dabei haben sie sogar einen Krieg überstanden. Der einzige Grund weshalb der Film keine zehn Punkte bekommen kann ist weil auch in diesem Film Truffauts die Entscheidungen der Charaktere irrational wirken und den Zuschauer ab einem gewissen Punkt auf Armlänge halten. Zumindest Catherine. Vielleicht gewollt, aber ebenso schwer zu folgen.
Jules und Jim (OT: Jules et Jim), Frankreich, 1962, François Truffaut, 105 min, (8/10)

Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7
Am 21. Juni irrt eine Frau verzweifelt durch Paris. Der Tag ist sowieso schon der längste Tag des Jahres, Sommersonnenwende. Aber für Cleo (Corinne Marchand) ist jede einzelne Minute eine Geduldsprobe. Sie befürchtet Magenkrebs zu haben und wartet auf den Befund ihres Arztes. Der Film beginnt damit, dass sie sich Tarotkarten legen lässt und vom schlimmsten ausgeht. Mal nervös, mal verletzlich zieht sie durch die Straßen von Paris, trifft sich mit ihrer Angestellten Angèle (Dominique Davray) und ihren Kollegen, die ihre Musik komponieren um ein paar Stücke einzuüben. Cleo ist Chansonette, aber ein trauriges Lied macht sie noch nervöser und verzweifelter und sie flieht wieder auf die Straßen von Paris auf der Suche nach Ablenkung. Der Film ist quasi in Echtzeit gedreht. Die einzelnen Episoden sind durchnummeriert und mit Zeitangabe versehen. Die Kamera folgt Cleos Irrfahrt, Route und Blicken. Mal sehen wir in Ich-Perspektive wie ihr Blick einer von bröckeligem Mörtel geäderten Wand beim heruntergehen einer Treppe folgt, mal sehen wir wie ein stiller Beobachter Cleo durch die Straßen laufen und mal als unsichtbare Kamera frontal wie sie mit ihrer Freundin in einer rostigen Karre durch Paris fährt, die so alt ist, dass sie keinen Blinker hat und die Frauen die Hände als Zeichen zum Abbiegen raushalten müssen.
Es ist rasant, es wird nie langweilig, es ist entlarvend – auch wenn niemand das Geschehen kommentiert, wissen wir, was sei denkt, wenn sie abstruse Begegnungen macht oder Vorzeichen begegnet. Sie vertraut sich verzweifelt den Menschen in ihrem Umfeld an. Cleo ist etwas neurotisch und extrovertiert. Will geliebt werden, will, dass sich die anderen Sorgen um sie machen. Agnès Vardas Film hat eine Protagonistin, die anfangs etwas naiv ist, eine Lebefrau, für die alles Schöne das Geschäft und der Inhalt ihres Lebens ist. Sie sagt „Solange ich schön bin, bin ich tausend mal mehr lebendig als alle anderen“ und beruhigt sich beim Anblick ihres schönen, ebenmäßigen Gesichts im Spiegel. Im Gegensatz dazu lässt uns Varda auch die Gedanken anderer Menschen hören, die der Meinung sind, dass Cleo so schön sei, dass sie doch keine Sorgen haben kann. Da treffen sich wohl mehrere Trugschlüsse. Letzten Endes kann jeder Cleo nachfühlen wie es ihr geht. Das Leben war eben noch perfekt, ohne dass man es als solches anerkannte, dann sieht man sich plötzlich mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Wer kann es ihr verübeln? Für Cleo wird der Gang durch Paris ein tröstliches Erlebnis und zu einem der Selbsterkenntnis. Letzten Endes stellt sie sich das erste Mal selbst in Frage. Reißt sich die Perrücke vom Kopf und die übertriebenen Hüte, schaut sich ohne den Ganzen Tand an. Kaum zu glauben, dass Regisseurin Agnes Varda Ende März selbst an Krebs verstarb. Unvergessen bleibt die Odyssee Cleos, die sie an ihrer Angst wachsen lässt und die Bilder von Paris, die den den Zuschauer in die 60er Jahre versetzen, schnelllebig, sommerlich, lebendig – ein Film wie Fernweh, an dem auch wir ein wenig wachsen. Übrigens wird während des Films ein Kurzfilm gezeigt, den Cleo und eine Freundin im Kino schauen. Die Darsteller des Films sind verschiedene Größen der Nouvelle Vague wie die Schauspielerin Anna Karina und Regisseur Jean-Luc Godard.
Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7 (OT: Cléo de 5 à 7), Frankreich/Italien, 1962, Agnès Varda, 90 min, (9/10)

„Video Essay: Death and the Maiden („Cleo from 5 to 7″, Agnès Varda)“, via Idàn Sagiv Richter (Youtube) – analysiert den ganzen Film, Spoiler sind zu erwarten
Die Außenseiterbande
Frau trifft zwei Männer, Männer planen Raub, Frau hilft Männern. Irgendwie zu einfach, oder? Tatsächlich ist Odile (Anna Karina) nicht sehr glücklich mit ihrem Job als Hausmädchen im Haushalt der betuchten Madame Victoria (Louisa Colpeyn). Franz (Sami Frey) lernt Odile in einem Englischkurs kennen und erfährt, dass sie in einem reichen Haushalt angestellt ist. Der Plan gedeiht, aber Odile zögert. Als Franz seinen Kumpel Arthur (Claude Brasseur) einweiht und Odile sich in ihn verliebt, willigt sie ein ihnen zu helfen Madame auszurauben. Tatsächlich braucht es einiges an Hin- und Her bis der Raub geschieht. Die Motivation der Männer und Odiles ist relativ dünn. Der Fokus liegt auf den Beziehungen der Drei untereinander. Franz liebt Odile, Odile liebt Arthur. Odile weiß aber, dass Franz sie liebt. Und Franz sieht deutlich, dass Odile Arthur lieber mag. Erschwerend kommt hinzu, dass sie alle etwas wollen – ein besseres Leben. Und sich dafür zusammen reißen müssen. Der Erzähler teasert immer wieder an, etwas über die Gefühle der Drei zu sagen, nur um dann festzustellen, dass das auf der Hand liegt. Tut es! Dei Drei sind ein Trio Infernal. Sie haben irrwitzige Ideen. Beispielsweise rennen sie einmal um sich die Zeit zu vertreiben durch den Louvre und stoppen ihre Zeit. Ein Rekord, der später in Bertoluccis Film Die Träumer von Eva Green und ihren beiden Männern gebrochen wird. Die Drei und ihre Gruppendynamik zu beobachten alleine bringt Spaß – wie sie tanzen, wie sie trinken und sich heimlich das Getränk des jeweils anderen unterjubeln. So witzige und lockere Szenen mit einer stillen Selbstverständlichkeit gefilmt wie sie das heutige Kino größtenteils vermissen lässt. Und so lässt sie uns die dünne Idee mit dem Raub vergessen. Sehr passend, da sie sowieso eine Parodie auf Pulp-Storys mit halbseidener Handlung ist. Aber wie so oft im Nouvelle Vague holt unsere Protagonisten die Realität ein.
Die Außenseiterbande (OT: Bande à part), Frankreich, 1964, Jean-Luc Godard, 97 min, (7/10)

Meine Nacht bei Maud
Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) fokussiert sich. Er unterhält keine engen Freundschaften und er lässt sich nicht mehr auf Gelegenheitsbekanntschaften oder lockere Affären mit Frauen ein. Der Katholik und Mathematiker ist in seinen Grundsätzen bestimmt: er sucht eine Partnerin, mit der er das Leben verbringen kann. Als er im verschneiten Clermont-Ferrand wegen des plötzlichen Winterwetters nicht mehr fahren kann und nach einem Treffen mit Freunden bei der geschiedenen Maude (Françoise Fabian) bleiben muss, entsteht ein Gespräch über Für und Wider von Beziehungen und dem Traum vom glücklich bis ans Lebensende werden. Das Aufeinandertreffen der Ansichten von Maude und Jean-Louis sind eigentlich faszinierend, wenn es nicht ein ewig währender Dialog ohne größere Spannungskurven wäre, der sich fast zwei Stunden dahinzieht. Die Merkmale des Nouvelle Vague und pointierte Erzählung und Andeutungen lassen sich nur am Anfang erkennen, als Jean-Louis versucht seiner Angebeteten und Traumfrau durch die engen Straßen Clermont-Ferrands zu folgen. Eine lockere mit der Handkamera gedrehte Szenen. Der Rest ist ein Kammerspiel angelehnt an Schriften Blaise Pascals für das man besser einen Kaffee oder zwei während des Schauens trinken sollte. Das diskutierenswürdige Thema wurde leider sehr nüchternd inszeniert.
Meine Nacht bei Maud (OT: Ma nuit chez Maud), Frankreich, 1969, Éric Rohmer, 110 min, (4/10)

Hitchcock/Truffaut
Kein Film, der Nouvelle Vague, aber ein Dokumentarfilm, der das Aufeinandertreffen zweier legendärer Filmemacher, die auf ihre jeweils eigene Art das Kino revolutioniert haben. In den 60er Jahren begann ein Briefwechsel zwischen Truffaut, einem großen Verehrer Hitchcocks, und „Hitch“. Truffaut schlug u.a. ein Interview von Filmemacher zu Filmemacher vor. 1962 trafen such die beiden Größen eine Woche lang zu einem insgesamt ca 50-stündigen Interviewmarathon, aus dem das in Deutschland unter dem Titel Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? erschienene Buch Truffauts über Hitchcock entstand. Der Dokumentarfilm enthält außerdem Auszüge aus Gesprächen mit anderen Regie-Größen wie Martin Scorsese, David Fincher, Richard Linklater, Wes Anderson und Kiyoshi Kurosawa und geht auf einige biografische Details von Hitch und Truffaut ein und ihr Werk. Hitchcock war ein Vorreiter des Kinos, das auch gleichzeitig Kunstform ist. Seine Erzählungen, der ihm eigene visuelle Stil und die (quasi) Erfindung des Suspense zogen die Menschen ins Kino und demonstrierten wieviel Filme verrichten können. Der Ruhm kommt aber meist auch mit der Frage einher, ob er sich in seinen spätere Jahren durch das Blockbuster-Kino selbst limitiert hat. Hitchcocks System und der Fokus auf fantastische Bilder und akribisch geografisch geplante Szenen sind etwas, das Filmemacher der Nouvelle Vague wie Truffaut von ihm gelernt haben. Plötzlich war nur nur das warum im Film wichtig, sondern auch das wie. Der Eindruck und die Gefühle, die beim Zuschauer erzeugt werden. Aber Truffaut und die Filmemacher der Nouvelle Vague restriktierten ihre Schauspieler und Mitwirkenden nicht so stark wie Hitchcock, was wohl einer der größten Unterschiede sein dürfte. Außerdem wirkt aus heutiger Sicht vieles an der Darbietung der Schauspieler in Hitchs Filmen gekünstelt und unnatürlich, da ihr Ausdruck und ihre Handlungen meistens der Stimmung dienen sollen. Nachdem man sich etwas mit der Nouvelle Vague beschäftigt hat, tritt der Unterschied besonders hervor, da die Rollen dort erfrischend normal und unpathetisch gespielt werden. Sehr schade ist, dass sich die Doku so stark auf Hitchcok ausrichtet. Die Analyse seiner Filme wie Vertigo oder Die Vögel ist zwar gut gemacht, aber im Titel steht auch Truffaut, dessen Visionen eindeutig zu kurz kamen.
Hitchcock/Truffaut, Frankreich, 2014, Kent Jones, 80 min, (7/10)

Verblüffend wie lebendig die Filme wirken, dafür das die meisten Leute Schwarzweißfilme aus den 60er Jahren eigentlich mit drögem Kino für schläfrige Tage verbinden. Tatsächlich haben einige der Filme so ihre Längen, weil es irgendwann den „turning point“ gibt, der uns wieder in die Realität entführt. Vorher habe ich tatsächlich keinen Nouvelle Vague Film gesehen – das war mein Erstkontakt und ich habe den sehr genossen. Nouvelle Vague fühlt sich tatsächlich anders an. Die wahrscheinlich größte Überraschung war für mich Agnès Vardas Film „Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7“, der auf ganzer Linie überzeugt hat. Die filmischen Mittel und die Botschaft des Streifens greifen unglaublich gut ineinander. Das Flair steckt an – sommerlich, hoffnungsvoll, lebendig. Und doch bin ich eher zufällig über den Film gestolpert. Ich las einen Artikel über Agnès Varda in einem Blog, ursprünglich angezogen durch den Fakt, dass es eine Filmemacherin war, deren Namen ich nicht kannte. Las in dem Artikel, dass sie die „Großmutter Nouvelle Vague“ sei, war überrascht. Warum kannte ich sie nicht trotz meiner aktuellen Recherche über Nouvelle Vague? Nur ein, zwei Tage später sah ich rein zufällig beim Zappen, dass auf Arte ein Film von Agnès Varda lief – „Cleo“, schaute ihn, war begeistert. Aber dieses trotz Recherche rein zufällige Erlebnis fühlt sich nicht so an, als ob Agnès Varda offen eine Begründerin des Nouvelle Vague ist und offenbart meinen wohl größten Kritikpunkte an der Filmströmung: Den unterschwelligen Patriarchalismus.
Während sich Varda in ihren Filmen auf eine Botschaft konzentriert und eine weibliche Hauptdarstellerin hat, sind die Frauen und Meinungen über Frauen in den Filmen Godards und Truffauts frappierend banal. Femme fatale oder Dummchen, ein Instrument und eine schöne Zierde für den Mann, geprägt von der Überzeugung der männlichen Überlegenheit. Filme des Nouvelle Vague fühlen sich dadurch wie sie gefilmt sind so modern an als wären sie aus dem Hier und Jetzt, aber die Beziehung der Geschlechter bildet das nicht so oft ab. Das Bild wird dadurch abgerundet, dass Varda als „Großmutter Nouvelle Vague“ bezeichnet wird (was man als abschätzig betrachten kann, aber nicht muss), während man bei der Recherche über Nouvelle Vague fast immer nur Godard und Truffaut erwähnt findet. Schade! Nichtsdestotrotz kann ich die FIlme der Nouvelle Vague sehr empfehlen, aber der „Rant“ musste sein.
„Inspiration and good mood: THAT’S CINEMA! | Agnès Varda | TEDxVeniceBeach“, via TEDx Talks (Youtube)
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
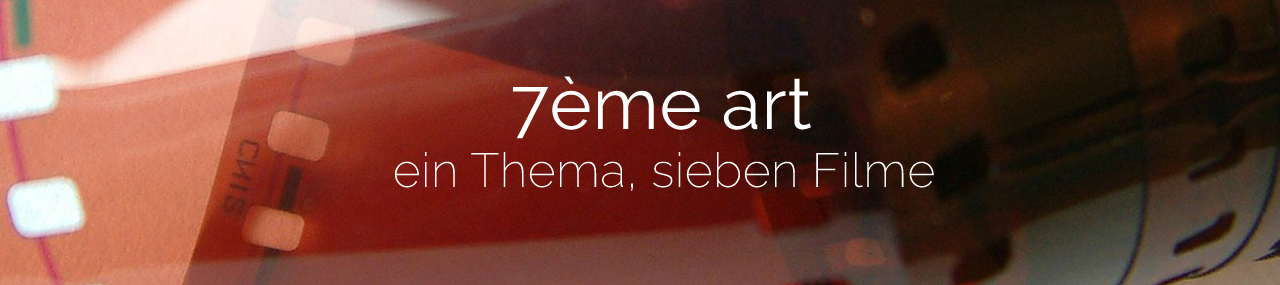
Schreibe einen Kommentar