Das passiert ja selten, dass ich im Zuge der alljährlichen Oscar-Werkschau so unterschiedliche Genres präsentieren darf bzw. die Academy sich mal in mehr Bereichen umgeschaut hat als Drama. So wartet die Liste der Nominierten Filme neben Drama auch mit Action, Science-Fiction/Fantasy und Horror auf. Ziemlich enttäuschend ist aber, dass viele Filme noch keinen deutschen Kinostart hatten. Auf ‚Call Me By Your Name‘ und ‚Lady Bird‘ mussten wir bisher verzichten und als Trost mit einem Tränchen im Auge ihre Trailer schauen, bis die Filme im März und April dann vielleicht auch endlich bei uns laufen. Ich dachte wir wären über solche Dramen bereits hinweg, in den letzten paar Jahren hat das besser geklappt. Wie dem auch sei: der gemeinsame Nenner der heute besprochenen Filme ist, dass sie 2018 für einen Academy Award nominiert wurden.
Baby Driver
Seinen Namen muss er öfter buchstabieren: Baby (Ansel Elgort). Er fällt mal mehr mal weniger positiv dadurch auf, dass er ständig Musik hört und meistens Sonnenbrille trägt. Von seiner Umwelt wirkt er etwas abgesondert. Seinen Lebensunterhalt verdient er auf eine Weise, die ihm zuwider ist. Er ist Fluchtwagenfahrer. Dabei stört ihn nicht das Fahren. Er kann das wie kein anderer. Aber wenn durch seine speziellen, zu chauffierenden ‚Gäste‘ andere Menschen zu Schaden kommen, dann bringt ihn das raus. Babys Liebe zur Musik geht soweit, dass er einen bestimmten Song zu einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Fahrt in einem bestimmten Moment braucht. Aber er zählt die Tage bis er seine Schuld gegenüber Doc (Kevin Spacey) beglichen hat, der die Coups plant und Baby oft und gern als Fahrer engagiert. Als er aber die Kellnerin Debora (Lily James) trifft, ist es um ihn geschehen. Wie schon schmerzlich oft im Film gesehen, macht die Liebe ihn aber auch angreif- und erpressbar.
Edgar Wright hat das mit der Musik bei Baby Driver ernst gemeint. Der Film hat möglicherweise einen der besten Soundtracks des Kino-Sommers 2017. Am auffälligsten ist aber, dass Baby die Atmosphäre bestimmt. Mit den Songs gibt er den Takt des Heists und auch den seines Lebens vor. Er lebt alle Szenen mit perfekter musikalischer Untermalung und bevor er nicht den passenden Song gefunden hat, geht’s nicht weiter. Man könnte meinen, dass hier nicht die Szene die Auswahl der Filmmusik und des Soundtracks bestimmt, sondern andersrum. Während Wrights frühere Filme, insbesondere Hot Fuzz und Shaun of the Dead, visuelles Storytelling demonstrieren und meistern, ist es hier ein eher auditives Storytelling, das Songs und Handlung abstimmt. Nicht selten sind es Szenen, Sprünge, Bewegungen, ein Spaziergang zum Kaffeeholen oder eine rasante Verfolgungsjagd, die durch Schnitte aber auch manchmal durch schiere Planung auf den Bass oder Drum eines Songs passen. Edgar Wright und das große Team hinter Baby Driver hat ein weiteres Mal das Metier gemeistert, wo andere nur mit Sex, Drugs und Special Effects um sich werfen. Aber. Ja, es gibt ein Aber. Die Handlung ist ein bisschen mau. So sympathisch Newcomer Ansel Elgort und Lily James auch sind, so sehr einen die Bonny-und-Clyde-angehauchte Story um Buddy (Jon Hamm) und Darling (Eiza González) rührt, so Badass Jamie Foxx als Bats und Jon Bernthal als Griff sind, die Geschichte haut einen nicht aus der Kurve. Es gibt zig Momente, in denen man sich fragt wie Baby zu seiner Entscheidung kommt, warum hat er nicht dieses oder jenes Mal anders gehandelt, seinen oder Deboras Kopf frühzeitig aus der Schlinge gezogen!? Geschichten nach diesem Schema hat man zu oft gesehen.
Baby Driver, USA/UK, 2017, Edgar Wright, 113 min, (7/10)

Dunkirk
Im zweiten Weltkrieg wurden in Dünkirchen, Frankreich, die britischen Truppen eingekesselt. Die Soldaten warteten am Strand auf ihre Rettung wie auf dem Serviertablett. Von überall her war der Feind zu erwarten. Aus der Luft, der See, hinter den Dünen. Die Umgebung und Situation ist der taktische Todesstoß für ein Evakuierungsmanöver. Und das merkt man dem Film zu jeder Zeit an. In vier parallel, aber nicht linear(!), ablaufenden Handlungssträngen wird das Schicksal der Männer mit der Betonung auf den Überlebenskampf erzählt und nicht das ewige Wer-gegen-Wen des Krieges. Bei Dünkirchen versucht Commander Bolton (Kenneth Branagh) soviele Männer wie möglich vom Strand wegzubekommen. Zu den Soldaten, die vom Strand wegwollen gehören Tommy (Fionn Whitehead), Alex (Harry Styles) und Gibson (Aneurin Barnard). Die versuchen sich teilweise auf Schiffe zu schmuggeln, indem sie sich als Sanitäter ausgeben und Verletzte transportieren, nur um endlich in Sicherheit zu kommen. In der Luft versuchen währenddessen Farrier (Tom Hardy) und Collins (Jack Lowden) die Gegner abzuschießen, die gnadenlos den Strand und die Schiffe bombardieren. Und auf See versucht der zivile Mr. Dawson (Mark Rylance) zusammen mit seinem Sohn und dessen Freund auf seinem Boot Soldaten aus Dünkirchen zu holen, wobei sie u.a. einen Soldaten (Cillian Murphy) aus dem Meer ziehen, der schwer traumatisiert ist und sie dazu bringen will nicht nach Dünkirchen zu fahren.
Nolan grast dabei alle Dimensionen dieses Manövers ab. Zu Land, im Wasser, in der Luft. Facettenreichtum ist hier das Schlagwort, nicht nur was die Fronten des hier abgebildeten Teilstück des Krieges betrifft. Bei den Charakteren ist alles dabei. Die bis hin zur Dummheit mutigen, die aufopfernden, die feigen, die traumatisierten, die unglücklichen und die die Glück haben. Dieser Kriegsfilm ist ein deutlicher Antikriegsfilm, denn er skizziert wie egal im Krieg plötzlich die Fronten werden, die Meinungen und manchmal auch die Ehre. All die Dinge, die den Krieg erst auslösten (in den meistens Fällen). Letzten Endes ist da nur der Überlebenskampf und holt aus manchen Soldaten das Äußerste heraus, während das Leben anderer mehr aus Zufall ausgelöscht wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Nolan darauf verzichtet die Deutschen als Feindbild darzustellen und zu erwähnen. Anders als in zig anderen Kriegsfilmen, die mit Stereotypen um sich werfen, geht es hier um den Menschen und der Feind ist der Tod. Und das wird dem Zuschauer nur mehr als deutlich durch die Beteiligten, deren Namen nicht so oft verlautbart werden wie der des unvermeidlichen Regisseurs und Drehbuchschreibers Christopher Nolan. Als da wären Hoyte van Hoytema für die Kamera, Lee Smith für den Schnitt, Hans Zimmer für die Musik und Richard King für die Soundeffekte. Sie machen den Film zu einem Erlebnis, dass sich haarsträubend realistisch anfühlt. Vor Allem vor dem Sound Design und Mixing ziehe ich den Hut, denn selten hat sich das Pfeifen der Bomben, die sich den Weg durch die Luft bahnen so realistisch und bedrohlich angefühlt. Die Schrecken des Krieges auf Film: Krieg ist furchtbar und furchtbar sinnlos.
Dunkirk, USA/UK/Frankreich/Niederlande, 2017, Christopher Nolan, 107 min, (10/10)

„Dunkirk – Trailer 1 [HD]“, via Warner Bros. Pictures (Youtube)
Get Out
„Finden Sie, dass man es in der heutigen Zeit als Afroamerikaner einfacher oder schwerer hat?“ wird Chris (Daniel Kaluuya) auf der Gartenparty bei den Schwiegereltern-in-spe gefragt. Eine von vielen Situationen, bei denen er heute lieber davonlaufen würde. Er ist das erste Mal bei der Familie seiner Freundin Rose (Allison Williams) zu Besuch und dass er schwarz ist, sollte eigentlich kein Thema sein. Anfangs, als nur die Eltern und das Pärchen da waren, machte es auch den Eindruck. Als dann aber die alten, weißen Eliten zu einer Gartenparty zusammenkommen, wird die Situation immer seltsamer. Die wenigen Schwarzen verhalten sich merkwürdig. Als Chris einen von ihnen fotografiert, hat dieser einen heftigen Anfall und sagt ihm, dass er verschwinden soll. Deutlicher könnte die Botschaft kaum sein.
„GET OUT Trailer German Deutsch (2017)“, via KinoCheck (Youtube)
Jordan Peele gab an, dass er mit dem Titel auf das ungute Gefühl des Zuschauers anspielen will, dass ab den ersten Minuten auf dem Anwesen der Eltern sagt „Junge, hau ab dort“. Die Vorboten sind sogar noch deutlicher. Als Chris und Rose auf dem Weg zu ihren Eltern sind, fahren sie ein Reh an. Chris wird sich in den folgenden Tagen noch öfter selber wie die Beute eines Jägers fühlen. Zu Recht? Es wird im Film früh deutlich gemacht, dass er tatsächlich das Anwesen nicht mehr verlassen wird, wenn es nach bestimmten Leuten geht. Damit ist der Film zu einigen Teilen vorhersagbarer als man das beim noch kryptischen und ziemlich guten Trailer erwarten mag. Aber wie die exakten Zusammenhänge sind, entfaltet sich erst nach und nach und hat einen Twist, den man tatsächlich mal nicht vorhersehen konnte. Deswegen sei an dieser Stelle nicht mehr verraten als dass der Afroamerikaner hier einer anderen Form der Diskriminierung ausgesetzt ist. Nicht etwa der Herabwürdigung, sondern der Glorifizierung. Die endet in einer Form der Ausbeutung, die nicht minder schockierend ist. Dabei schafft es Jordan Peele einen Film abzuliefern, der seiner eigenen Vorhersagbarkeit zu großen Teilen trotzt und konstant Spannung hält. Es gibt nur zwei bis drei echte jump scares und der Rest ist gut und neu und kommt weitestgehend ohne überstrapazierte Horror-Tropen aus. Jordan Peele schafft es sogar, dass der Film zwischendrin witzig sein darf ohne in das absurde und dümmliche abzugleiten. Die Comedy-Momente werden von Chris‘ Freund Rod (Lil Rel Howery) getragen und dürften keine Sekunde länger dauern. Der Film ist vielleicht nicht der große Wurf, den man aufgrund des überschwänglichen Lobs der amerikanischen Presse erwartet, aber er spricht auf moderne Art über die schwarze Identität in der heutigen Gesellschaft und schafft es das Horrorgrenre vorrangig durch Story und Atmosphäre zu beleben, was viele Filme der letzten Jahre vermissen lassen.
Get Out, USA, 2017, Jordan Peele, 104 min, (8/10)

Loving Vincent
Loving Vincent ist eine Verbeugung vor dem verkannten Künstler Vincent van Gogh (Robert Gulaczyk). Der Film wurde zuerst mit echten Darstellern in Kostüm gedreht und dann von Künstlern Frame für Frame als Ölgemälde nachgemalt. Viele davon im unverkennbaren Stile van Goghs. Das ist mit Liebe gemacht. Der Film handelt von Armand Roulin (Douglas Booth), der von seinem Vater Joseph (Chris O’Dowd) den Auftrag bekommt einen Brief zu überbringen. Aber der Brief scheint unzustellbar zu sein. Es ist ein Brief von Vincent van Gogh an seinen Bruder Theo. Vincent ist inzwischen verstorben. Er nahm sich das Leben. Der Brief an seinen Bruder gelangte erst einige Zeit später in Josephs Besitz und da er ein Freund Vincents war ist es für ihn eine Frage der Ehre dafür zu sorgen, dass der Brief ankommt. So macht sich Armand auf den Weg Theo zu finden, was in einer Reise mündet, bei der er letzten Endes v.A. versucht zu ergründen, warum sich Vincent umgebracht hat.
„Loving Vincent | Offizieller Trailer Deutsch HD | Jetzt im Kino“, via Weltkino Filmverleih (Youtube)
Van Goghs Geschichte ist eine tragische, gilt er doch heute als der Begründer der modernen Kunst und war damit seiner Zeit voraus, wurde damals nur als Möchtegern und weltfremder Träumer behandelt. Für seine Empfindsamkeit und die Visionen zu malen wie er empfindet, gab es erst nach seinem Tod Verständnis. Wie schnell man verkennt, was über dem eigenen Horizont liegt, zeigen viele seiner Zeitgenossen. „Der erste Film der Welt aus Ölgemälden“ ist ein Projekt mit viel Herzblut. Öl ist keine einfache Technik und erfordert Geduld. Über 65.000 Gemälde wurden für dieses Projekt von 80 Künstlern angefertigt, die dann per CGI in die zuvor gefilmten Szenen eingepasst wurden, um den Eindruck eines sich bewegenden Kunstwerks zu erzeugen. Ein Mammutprojekt, das seinem Zweck bis in die letzte Sekunde durch und durch dient. So wurden Schlüsselszenen an bekannte Gemälde van Goghs angepasst. Man sieht Die Ebene von Auvers, Porträt des Dr. Gachet, Das Nachtcafé, Sternennacht, Das Schlafzimmer des Künstlers im Gelben Haus und noch viele weitere Bilder van Goghs, die sich natürlich in das Geschehen einfügen. Rückblicke wurden in Schwarzweiß-Sequenzen gemalt und nicht im Stile van Goghs, sodass sich das Auge zwischendurch erholt. Der Film verschluckt einen und man findet sich in einer bunten Welt aus Pinselstrichen wieder. Einer Optik, die ich so in noch keinem Animationsfilm gesehen habe. Gemaltes Kino. Wunderbar. Eine liebevolle Verbeugung vor dem Künstler, die auch erzählerisch trotz des langsamen Starts überzeugen kann.
Loving Vincent, UK/Polen, 2017, Dorota Kobiela/Hugh Welchman, 94 min, (8/10)

„Star Wars: Die letzten Jedi – Offizieller Trailer (Deutsch | German)“, via Star Wars Deutschland (Youtube)
Star Wars: Die letzten Jedi
Nach dem Cliffhanger in Episode VII bei der Rey (Daisy Ridley) den emeritierten Luke Skywalker (Mark Hamill) aufsucht, erwartet sie in ihm einen Lehrmeister zu finden oder zumindest dazu zu bewegen, sich dem Widerstand anzuschließen. Allerdings hat der weder an dem einen, noch an dem anderen das geringste Interesse. Er hat sich von der Macht abgewandt. Während beide nebeneinanderher granteln, beginnt Rey Kilo Ren (Adam Driver) trotz großer Distanz ständig wie in einer Vision zu sehen und er sie, so als ob sie durch die Macht verbunden sind. In ihren Streitgesprächen erfährt sie, dass Kylo Ren einst ein Schüler Skywalkers war bis etwas vorgefallen ist, das alles verändert hat. Bei dem Obersten Anführer Snoke (Andy Serkis) hat Kylo Ren einen schlechten Stand, seitdem er von der Novizin Rey besiegt wurde. Währenddessen wird die Flotte des Widerstands von der ersten Ordnung verfolgt, scheinbar gibt es trotz Hyperraumsprung keine Möglichkeit ihnen zu entkommen und der Widerstand rund um General Leia Organa (Carrie Fisher) gerät an die Grenzen ihrer Mittel und muss herbe Verluste einstecken. Poe Dameron (Oscar Isaac) will dabei nicht kuschen und versucht zusammen mit Finn (John Boyega) und der Technikerin Rose (Kelly Marie Tran) eine gewagte Aktion, für die sie vom Widerstand kein grünes Licht bekommen haben.
Es ist ein Jammer das sagen zu müssen, aber: der Film macht in der Fortführung der Handlung keinen Unterschied. Das klingt traurig, oder? Das ist es. Es ist sehr viel passiert, der Zuschauer wird 152 Minuten unterhalten. Im Grunde auch gut unterhalten. Aber die Lage vor dem Film deckt sich mit dem wie es nach dem Film ist. Und das ist dann recht dünn. Rian Johnson, der sowohl Regie führte als auch das Drehbuch beisteuerte, gelang es nicht den typischen Fluch des mittleren Films einer Trilogie zu brechen. Sehr widrig sind aber auch die verpassten Chancen der Charaktere. Die werden sich ihrer Mittel scheinbar immer erst relativ spät bewusst. Leia und die Macht, Vizeadmiral Holdo (Laura Dern) und das Schiff, der Weg aus der Mine und einiges mehr. Der Zuschauer denkt stets: und darauf sind sie nicht früher gekommen? Aber es gibt auch ein Plus: die Charakterentwicklung überzeugt meistens. Während Rey auf Lukes Insel mit der Verantwortung konfrontiert wird, die die Macht mit sich bringt, ist sie konsequent. Sie stellt sich der dunklen Seite. Bei Kylo Ren/Ben Solo ist das anders. Er ist wie zuvor Anakin einer, in dem man die dunkle Seite sah und sich so davor fürchtete, sodass man den jungen Mann vor lauter Bedenken und Angst der dunklen Seite annäherte. Und dass in ihm ein Konflikt zwischen Gut und Böse oder etwas dazwischen gärt, ist in diesem Film spürbar. Die Chemie zwischen Rey und Kilo Ren funktioniert. Der Film vermag es auch Kilo Ren ein Profil zu geben, das ihm in Das Erwachen der Macht noch fehlte und Adam Driver eine bessere Bühne zu geben. Allgemein wird aber Die Erste Ordnung zu sehr als dysfunktionales Organ dargestellt, das man nicht fürchten kann, obwohl man es müsste. Die Gleichung geht nicht auf. Schauwerte bietet der Film allemal, allerdings muss man auf die ein bisschen warten. Ikonische Szenen erwarten den Zuschauer spätestens ab der Szene in der Rey und Kylo Ren einmal gezwungenermaßen Seite an Seite kämpfen. Die Kampfszenen und das alles beherrschende Rot brennen sich ein und es wirkt wie ein Augenaufschlag nach langer Dunkelheit. Genauso wie die Schlacht auf dem Mineralplaneten Crait, auf dessen mit Salz weiß überzogenem Boden die Gleiter, Raumschiffe und schweren Geschütze Spuren rot wie Blut hinterlassen. Das World Building kann mehr als sein Vorgänger. Ob man nun die Funkelfüchse/Vulptex, Porgs oder Fathiers lieber mag. Obwohl der Film was seine Einzelteile betrifft mehr überzeugt als der Vorgänger, ist die Handlung – die Summer aller Teile – leider aber nicht überzeugend.
Star Wars: Die letzten Jedi (Star Wars: The Last Jedi), USA, 2017, Rian Johnson, 152 min, (7/10)
The Shape of Water
Im Baltimore der 60 Jahre arbeitet Elisa Esposito (Sally Hawkins) als Reinigungskraft in einer wissenschaftlichen Einrichtung des Militärs. Sie ist stumm, kommuniziert über Gebärdensprache und führt ein entbährungsreiches Leben, in dem sie aber die Schönheit der kleinen Dinge feiert. Sie liebt es zusammen mit ihrem schwulen Nachbarn Giles (Richard Jenkins) Filme zu gucken, in denen getanzt und gesungen wird und bewahrt sich ein offenes und freundliches Gemüt. Dass sie nicht sprechen kann, gleicht ihre Freundin und Kollegin Zelda (Octavia Spencer) doppelt aus. In der Wissenschaftseinrichtung wird eines Tages ein Wesen eingeliefert, das ein Mensch-Amphibien-Hybride zu sein scheint und vom Sicherheitsbeamten Richard Strickland (Michael Shannon) grausam gequält wird. Da sie regelmäßig in dem Labor sauber macht, in dem das Wesen eingesperrt ist, sehen sie sich oft und es entsteht ein zartes Band. Aber es ist klar, dass Elisas neuer Freund dort nicht bleiben kann.
Bei The Shape of Water konnte sich Guillermo del Toro nicht so ganz entscheiden, was für einen Film genau er machen will. Elisas pragmatische Selbstbefriedigung nach Zeitplan scheint nicht mit dem Kitsch und der süßlichen Atmosphäre des restlichen Films zusammenzupassen. Es sind sehr viele Motive, die in die eigentlich recht überschaubare Handlung reingequetscht wurden. Das Psychogramm eines machtgeilen Mannes mit Gott-Komplex (Strickland), Rassismus, der kalte Krieg, Wettrüsten und zwischendrin deplatzierte Tanzszenen zwischen Frau und Amphibienmann, die im Stil alter Schwarzweißfilme inszeniert sind: das ist ein bisschen zu durchwachsen, nicht gut verbunden und fühlt sich so an als ob man alle 10 Minuten einen anderen Film sehen würde. Und einen Film, der ein wenig an ‚Die fabelhafte Welt der Amélie‘ erinnert. Der Rest aber, der Kern der Geschichte, ist eine wunderbare Hommage an diejenigen mit dem Herz am richtigen Fleck. Das sind leider zu oft diejenigen, die leidgeprüft sind und von anderen als Außenseiter verschrien werden. Oder wie Giles es sagt: die entweder zu spät oder zu früh geboren wurden. Es sind die Stummen, die mit einer Hautfarbe die manchen nicht passt, die mit anderer sexuellen Gesinnung, die Künstler, die Träumer, die die angeblich anders sind. Die größte Metapher darauf ist wohl der Amphibienmann – übrigens wieder einmal großartig verkörpert von Doug Jones. Für die Botschaft alleine hat der Film trotz seiner Mängel sehr viel Sympathie verdient und holt trotz manch befremdender Szenen wieder etwas raus. Und am Rande sei erwähnt, dass sich die Figur des Dr. Robert Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) angenehm von dem absetzt, was man von russischen Spionen in Filmen erwartet.
The Shape of Water, USA, 2017, Guillermo del Toro, 123 min, (8/10)

„THE SHAPE OF WATER | Look For It On Blu-ray & DVD | FOX Searchlight“, via FoxSearchlight (Youtube)
Three Billdboards Outside Ebbing, Missouri
Mildred Hayes‘ (Frances McDormand) Tochter wurde auf einer Straße in Ebbing, Missouri entführt, vergewaltigt und verbrannt. Der grauenerregende Tod lässt die Mutter v.A. deswegen nicht los, weil bisher nicht mal ein Verdächtiger festgenommen wurde. Mildred sieht ihre Chance gekommen die Ansässigen und die Polizei wachzurütteln und mietet kurzerhand drei heruntergekommene Plakatwände und lässt sie bekleben. Hintereinander liest man nun im Vorbeifahren „Raped While Dying“, „Still No Arrests?“ und „How come, Chief Willoughby?“ Eine Kampfansage, die einiges in Ebbings sauberem Trott durcheinanderbringt.
Obwohl der Film nach einem harten Drama klingt, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Tragische und schockierende Momente wechseln sich mit bissigen Kommentaren und Aktionen Mildreds und sogar Charakteren die für Comic relief sorgen wie die neue Freundin von Mildreds Ex-Mann, die aussieht als ob sie noch beim Mickey-Mouse-Club auftritt. Die Mischung ist erstaunlich ausgewogen für den starken Stoff und der Film verdient sich in Perfektion den Titel Tragikömodie. Und das obwohl der Film sich nichts schenkt. Der durch die Plakatwände angegriffene Sheriff Bill Willoughby, gespielt von Woody Harrelson, wird schnell als aufrechter Typ charakterisiert, der alles in seiner Macht stehende versucht hat. Auch wenn das den Schmerz Mildreds nicht lindert. Da er todsterbenskrank ist, kommt der Bumerang auch zu Mildred zurück. Sie ist eine starke Frau, kennt scheinbar keine Angst und muss sich auch Anfeindungen stellen, sie bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone und reizt die immer mehr aus. Neben ihr ist aber wohl eine der krassesten Figuren Officer Jason Dixon. Eine Rolle in der Sam Rockwell brilliert und noch facettenreicher ist als Mildred, da er sich von einem rassistischen Officer zu einem entwickelt, der seine Lektion gelernt hat. So gut die Zutaten auch sind und so groß die Erleichterung ein ernstes Thema locker und spannend zu erzählen – ein bitterer Beigeschmack bleibt. Es gibt keine Erlösung, keinen gut gemeinten Ratschlag, kein Entkommen.
Three Billdboards Outside Ebbing, Missouri, USA/UK, 2017, Martin McDonagh, 166min, (8/10)

Merkt ihr’s? Ich habe heute versucht mich kurz zu fassen. 🙂 Da muss ich schon fast selber lachen 😉 In jedem Fall sind die Filme, die ich im Zuge meiner Oscar-Werkschau gesehen habe sehr abwechslungsreich. Ob ‚Get Out‘ typischer Oscar-Stoff ist? Eigentlich nein. Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet um ehrlich zu sein. Aber das werde ich nochmal an anderer Stelle diskutieren kurz bevor ich ganz gespannt die Oscars schaue. Allgemein begrüße ich die Entwicklung, dass auch Genres gewürdigt werden statt der unumgänglichen Dramen, Antikriegsfilme und Konsorten. Aber ob die sich auch bewähren? 13 Nominierungen für The Shape of Water ist schon eine ganze Menge mögliches Gold. Gibt es einen Film, den ihr hier vermisst, der euch besonders gut gefallen hat? Werdet ihr die Oscars verfolgen? Und welcher Film wurde eurer Meinung nach ganz sträflich bei den Nominierungen übergangen? Irgendwo flüstert jemand „Mother!“ …
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
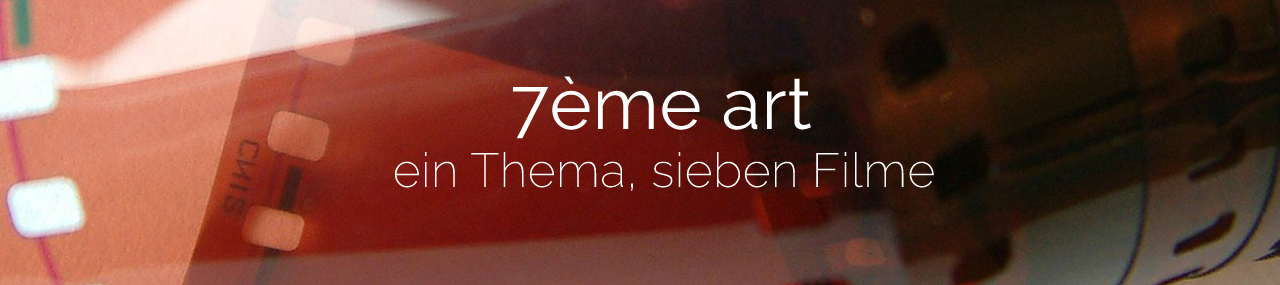
Schreibe einen Kommentar