Es gibt ein Jubiläum zu feiern. Mit dieser Ausgabe von „7ème art“ wurden offiziell über 1000 Filme hier im Blog alleine in dieser Beitragsreihe besprochen. Woah. Wie schön, dass das mit einer Ausgabe zusammenfällt, die auch noch die Awards Season adressiert. 😳 Ich überlege mir, ob ich dem Jubiläum einen eigenen Beitrag widme. Denn heute heißt es erstmal: and the Oscar (maybe) goes to … nachfolgende sieben Filme.
Der wilde Roboter
Gebt ihr doch eine Aufgabe! Roboter Rozzum 7134 strandet auf einer Insel und versucht eigentlich nichts anderes als ihre Aufgabe zu erfüllen. Während sie hilfreich sein will, verstört sie aber nur die Flora und Fauna. Immerhin entschlüsselt sie nach eingängiger Analyse die Sprache der Tiere und findet daher vielleicht doch etwas zutun. Als durch einen Unfall nur ein einziges Gänseküken übrig bleibt und in Rozzums mechanischen Händen schlüpft, ist da endlich die Aufgabe: Mutter sein. Und noch konkreter: dafür sorgen, dass der Kleine lernt zu essen, zu schwimmen und zu fliegen bevor der Winter einbricht.
Wenn man wie ich den Trend zum gummigesichtigen 3D-Animationsfilm der letzten gut zehn bis fünfzehn Jahre nicht mag, dann ist Der wilde Roboter eine Wohltat für die Augen. Mit aufwendigem Shading wird versucht einen (hand)gemalten Stil zu erzeugen und es gelingt. Nicht ganz zufällig, denn man suchte sich als Vorbilder die Filme Hayao Miyazakis und frühe (handgemalte) Werke Disneys. Der digitale Pinselstrich wird dabei v.A. auf Tierhaar und die wunderbare, sprießende, blühende Umgebung der Insel angewendet. Roz(zum) als mechanisches Individuum entzieht sich dem, stellt aber keinen Bruch dar. Die Geschichte um Ausgrenzung bzw. Othering bekommt den zu erwartenden Twist, dass was uns von anderen unterscheidet später als unsere Stärken erkannt wird. Dass Vielseitigkeit und Diversität am Ende bereichernd sind. Die Botschaft geht ähnlich ans Herz wie das Motiv von Verwandtschaft im Herzen und das Zusammenrücken einer Gemeinschaft trotz ihrer Differenzen (ja, es sind die Tiere gemeint 😉). Die vielen Motive haben aber auch einen seichten Nachteil: am Ende hat man das Gefühl drei Enden zu sehen. Und drei Mal zu heulen. Und sich zu fragen, wann der Film jetzt eigentlich wirklich zu Ende ist?
Der wilde Roboter (OT: The Wild Robot), USA, 2024, Chris Sanders, 102 min, (8/10)

Dune: Part Two
Die Handlung von Part Two setzt nahtlos an den ersten Teil an. Paul Atreides (Timothée Chalamet) hat sich den Respekt der Fremen rund um Chani (Zendaya) auf blutige Weise erkämpft. Sie werden von ihnen mit in eins ihrer Lager genommen. Während einige wie Stilgar (Javier Bardem) glauben, dass er ihr Messias ist, betrachten ihn andere argwöhnisch. Sowohl Paul als auch seine Mutter Lady Jessica (Rebecca Ferguson) werden sich das Vertrauen der Fremen auf unterschiedliche Weise verdienen. Worin Legendenbildung für Jessica ein Mittel ist, für Paul eine Last. Das Erstarken der Fremen veranlasst die Harkonnens zu noch brutaleren Maßnahmen. Aus der Ferne betrachtet Prinzessin Irulan (Florence Pugh), die Tochter des Imperators, das Geschehen mit Sorge.
Der zweite Teil von Villeneuves Verfilmung driftet deutlich mehr von der Vorlage ab als der erste. Das beschert uns ebenso wünschenswerte Entwicklungen (Chani ist stimmiger charakterisiert) wie diskutable (Chanis und Pauls Beziehung, eine sehr manipulative Lady Jessica). Auch greift das Buch einigen Details rund um Prinzessin Irulan voraus und öffnet einem dritten Film Tür und Tor. Darüber hinaus ist Dune: Part Two aber v.A. ein konsequent gestaltetes Sci-Fi-Epos und für mich immer noch die Verfilmung der Bücher, die ich mir gewünscht habe. Kostüme, Kulissen, Optik und das mächtige Sounddesign sind fulminant bis ins kleinste Detail – ins Wandgemälde, Flimmern des Spice, Kopftuch Chanis. Man nehme nur die unterschiedliche Farbgebung und leicht abweichende Gestaltung der Regionen von Arrakis – Sand kann nicht nur eine Farbe und Konsistenz. Meine unverhohlene Lobeshymne singe ich, obwohl dem Film am Ende gefühlt etwas die Zeit wegläuft. Trotz der kleinen Meckerei: ein Erlebnis.
Dune: Part Two, USA, 2024, Denis Villeneuve, 166 min, (9/10)

Emilia Pérez
Jacques Audiard schätze ich sehr für seinen Film Der Geschmack von Rost und Knochen und gönne ihm sehr den Erfolg mit Emilia Pérez, einem Film, der angenehm zwischen den Genres Krimi, Thriller, Drama und Musical(!) wandert. Im Zentrum der Handlung steht augenscheinlich die Anwältin Rita Moro Castro (Zoë Saldaña), die in Mexiko-Stadt lebt, arbeitet und ihr Talent vergeudet. Eines Tages wird sie von einem Drogenbaron mit einer Angelegenheit engagiert, die äußerstes Fingerspitzengefühl verlangt. Er will nämlich raus und ein neues Leben anfangen. Eines als Frau.
Rita nimmt an, kümmert sich um verschwiegene Ärzte, lässt ein altes Leben verschwinden und nach gewisser Zeit ist der Drogenboss Geschichte und Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón) geboren. Nur beginnt der Film hier quasi erst, denn Emilia fällt die Trennung von ihrer Familie und den Sünden der Vergangenheit nicht leicht. Das alles hat Audiard aus einem Romanfragment entwickelt und gemäß einer Geschichte voller Sehnen, Leidenschaft und großer Motive wie Identität, Schuld und Sühne in ein Musical gepackt. Ist es nun das Thema der Trans-Identität oder geschlechtsangleichender Operationen, der Musicalcharakter oder Gerede rings um den Film und seine Darsteller:innen – Emilia Pérez (der Film) polarisiert. Ich habe selten solche Lobreden auf der einen und solche Verrisse auf der anderen Seite gelesen und gehört. Ich gehöre zu den lobenden und Emilia Pérez hatte mich schon mit dem Satz Ritas: To change your gender is to change society. Denn unsere Geschlechterrollen und damit einhergehenden Probleme sind sowas von nichtig, wenn wir uns für den Gedanken öffnen, dass wir nicht mit dem auskommen müssen, was für Chromosomen gewürfelt wurden. Denn dann müssen wir füreinander Empathie empfinden. Das könntest du sein.
Die Wucht des Satzes demonstriert Emilias Geschichte auch, indem sie den richtigen und unbequemeren Weg gehen und die Drogenvergangenheit nicht aussparen, sondern adressieren. Narrativ muss man sich auf einige Sprünge einstellen, die aber willkommen sind. Als Musical ist der Film womöglich nicht jedermenschs Sache, doch der Ansatz ist interessant. Die Songs kommen eher unverkitscht daher und werden in die Handlung eingereiht, kombiniert mit Straßenszenen in Mexiko-Stadt, Galas und dem Beat von Maschinengewehren. Das weniger blumige der Choreografien wird aber sicherlich nicht nur Fans finden. Und das noch weniger, wenn man die Parallelen zwischen Geschlechtsidentität, Gewalt und Sehnen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht sieht.
Emilia Pérez, Frankreich, 2024, Jacques Audiard, 130 min, (8/10)

Konklave
Die meisten von uns wissen nicht wie so ein echtes Konklave abläuft und werden es nie erfahren, aber so spannend stelle ich es mir tatsächlich nicht vor. Wir erinnern uns: ein Konklave ist die Versammlung und Abstimmung über den nächsten Papst, sobald einer (von uns) gegangen ist. Edward Berger inszenierte einen Roman Robert Harris‘, der einen Blick hinter die fest verschlossenen Türen wirft. Denn das auch hier wohl interessanteste Merkmal der Wahl ist, dass sie nicht nur geheim ist, sondern die Wahlberechtigten eingeschlossen werden. Zuerst beginnt der Film aber mit der Nachricht über das Dahinscheiden des bisherigen Papstes, die dessen enge Vertraute besonders erschüttert. Allen voran Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes), der mit der Aufgabe betreut wird das Konklave zu planen und in leitender Funktion durchzuführen. Das ist bereits an sich eine fordernde Aufgabe. Hinzu kommt die Trauer, das Ränkeschmieden der Anderen und vor Allem sein innerer Glaubenskonflikt.
Kein Wunder, dass Fiennes für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert ist. Wir erfahren zwar nie, was Ursache seines Glaubenskonflikts ist, aber wir sehen ihm den an. Das Konklave leiten zu müssen, wiegt wie Blei auf seinen Schultern. Hinzu kommt neben dem dramatischen, der für uns spannende Teil. Es treten allerlei Ungereimtheiten auf, die ein zweifelhaftes Licht auf einige der Kardinäle werfen, die aber in den Abstimmungen weit vorn liegen. Mit seinen begrenzten Möglichkeiten versucht Lawrence dem nachzugehen. Dabei wirkt Konklave manchmal wie ein Ausschnitt unseres Zeitgeschehens – egal wo man hinschaut. Es erinnert an die Bundestagswahl und Parteien, die viel über Parteien reden, aber wenig über die Dinge, die Bürger:innen interessieren. Manchmal wirkt es wie ein Stammtisch voller ärgerlicher, älterer Männer. Es ist der Clash zwischen Kulturen und Sichtweisen, konservative vs. moderne. Ich hatte nicht erwartet in einem Film über ein Konklave die Welt im Kleinen vorzufinden. Die Frage, wer hier nun Dreck am Stecken hat und wer am Ende gewählt wird, macht aus Konklave unerwartet einen Thriller mit einem fein dosierten Hauch von Zeitgeist. Darin finden sich auch noch beachtliche Bilder und ein feiner Soundtrack, die alle insgesamt keinen Zweifel an der Sinnhaftigkeit der vielen Oscarnominierungen lassen.
Konklave (OT: Conclave), USA/UK, 2024, Edward Berger, 121 min, (9/10)

The Apprentice – The Trump Story
Es ist und war ein mega Aufhänger: Ali Abbasi macht einen Film über eine der wohl am meisten polarisierenden Personen unserer Gegenwart und dazu noch einen ehemaligen und leider wiedergewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Donald Trump. Seufz. In seine Rolle schlüpft Sebastian Stan, der sich damit wohl endgültig das Typecasting in RomComs und die alleinige Assoziation mit dem MCU abgestreift hat. Der Film beginnt mit der Begegnung Trumps mit dem umstrittenen Anwalt Roy Cohn (Jeremy Strong), von dem er sich einige Weisheiten abschaut. Erpressung: ok. Behauptungen zum Selbstwecke aufstellen: passt schon. Dabei wurstelt er sich mit Kontakten und Behauptungen so durch, plant größenwahnsinnige Projekte unter mehr als schwierigen und erlogenen Prämissen und versucht nebenbei das Model Ivana (Marija Bakalowa) abzuschleppen. Anfangs wirkt er dabei fast wie ein Fähnchen im Wind. Ein Typ, der doch gar nicht so schlimm ist. Ein unbeholfener, der gern größer wäre. Der von Roy Cohn irgendwie auf den falschen Weg geschickt wurde? Und das ist ein Teil des Problems.
Über diese Note kommt die zweite Hälfte hinweg, wenn sie Trump als wirklich ruchlos darstellt. Es gibt einige Szenen, bei denen man sich fragt, was wohl Trump selber oder Ivana davon hält? Aber ja, als Trump-Kritiker bekommt man in der zweiten Hälfte Futter und findet eher, was man in dem Film gesucht hat. Frappierend ist beispielsweise auch, dass er offenbar seinen bekannten Wahlspruch (Make America … ihr wisst schon) von Reagan abgeschaut hat. Wusste ich nicht. Die Sache ist nur die, finden Trump-Kritiker:innen hier Futter, so tun das möglicherweise Befürworter:innen in der ersten Hälfte. Mag Interpretationssache sein, aber lässt leider die Frage stellen, was sich Abbasi und Team von dem Film erwartet haben? Sollte es ein durchwirktes Portrait sein, das zum Nachdenken anregt? Ist es am Ende ein Zugeständnis: diese Person ist so polarisierend, dass wir ihr einen Film widmen müssen? Als der Film angekündigt wurde, hielt ich es für den richtigen Zeitpunkt. Heute für den fatal falschen.
Davon abgesehen ist The Apprentice in seinen Einzelteilen vom Titel bis über Maske und Kulissen interessant und sehenswert, wenn man sich mit der Causa Trump noch nicht satt gesehen hat ohne dass es einem sauer aufstößt. Der Titel spielt auf die Sendung an, in der Trump später Juror war, gleichzeitig darauf, was er alles vom umstrittenen Roy Cohn „gelernt“ hat. Quasi bei ihm in die Lehre ging. Der Look des Films fängt das 70er Jahre Flair ein. Sowohl Stan ist als Trump naja, noch wiederzuerkennen, aber sie treffen ihn gut. Man merkt, dass Stan Trumps Mimik, Gestik und Rhetorik studiert hat. Ein wenig spielt Jeremy Strong ihn aber schon an die Wand. The Apprentice ist am Ende ein entlarvender Film, ein schwierig einordbarer. Er wird vielen Argumenten in die Hände spielen und hinterlässt daher einen faden Beigeschmack. The Apprentice hätte entweder vier Jahre früher oder später gemacht werden sollen.
The Apprentice – The Trump Story (OT: The Apprentice), USA/Kanada, 2024, Ali Abbasi, 123 min, (7/10)

The Only Girl in the Orchestra
Obwohl ich ja eine gute, feministische Erfolgsstory schätze, konnte ich mit The Only Girl in the Orchestra umso weniger anfangen, desto länger(!) die Kurzdoku(!) war. Darin folgt Regisseurin Molly O’Brien ihrer Tante durch einige ihrer Tage rings um den letzten Tag im Orchester und beginnenden Ruhestand. Ihre Tante ist Orin O’Brien, Kontrabassistin und die erste Frau, die einst in das New York Philharmonic eingestellt wurde. Zu Beginn erzählt die Doku noch von der Sensation, die Orin darstellte, aber auch zu welchen abschätzigen und mysogynen Aussagen die Presse oder ihre Zeitgenossen kamen.
Da ist er – der bittere Beigeschmack, den es hinterlässt, wenn Gegenwart und Vergangenheit nebeneinandergestellt werden. Einerseits die schrägen Hürden, die Frauen hinter sich lassen mussten und andererseits den Respekt, den sie sich durch ihre Fähigkeiten erarbeitet haben, wie sehr sie geschätzt und verehrt werden. Natürlich schwingt damit auch Triumph mit. Danach ist es mehr als ob The Only Girl in the Orchestra ein Follow-me-around Orins wäre und ein slice-of-life-iges Portrait einer großartigen Musikerin. Die gesellschaftlich-kritischen Untertöne lassen nach und als Musikdoku hat es zu wenig Musik. Es freut mich sehr von Orin O’Brien erfahren zu haben, aber der Film könnte eine Pointe vertragen, der ihr Portrait rahmt.
The Only Girl in the Orchestra, USA, 2023, Molly O’Brien, 34 min, (6/10)

The Substance
Schauspielerin und Fitness-Ikone Elisabeth Sparkle (Demi Moore) wird pünktlich an ihrem 50. Geburtstag gefeuert. Ihr Produzent Harvey (Dennis Quaid) lässt keinen Zweifel daran, warum. Eine jüngere sucht er, schönere. Eine, die Ja und Amen sagt. Elisabeth ist am Boden zerstört und scheint überall nur Ablehnung entgegen gebracht zu bekommen. Da bekommt sie ein Angebot, dass in dem Moment zu attraktiv erscheint. Mit The Substance wird die Zellteilung angeregt, ein zweites Ich basierend auf ihrer DNA erschaffen. Sie tauft ihr neues, jüngeres Ich Sue (Margaret Qualley). Und Sue bewirbt sich um genau die Stelle, die Elisabeth verlassen musste. Der Deal hat natürlich einen Haken. Während die eine aktiv ist, geht die andere in eine Art Winterschlaf. Irgendwann aber erscheint Sues Leben reizvoller, erfolgreicher und vielversprechender als das von Elisabeth – zumindest denkt das Sue. Und verstößt gegen die Regeln. Nebenwirkungen inklusive.
Es macht wenig Sinn sich bei The Substance darüber zu beschweren, dass die männlichen Figuren so einseitig geraten sind oder darüber wie oft die Reize der Frauen immer wieder im Close-Up in die Kamera gehalten werden. Der Film ist In Your Face und so gewollt. Er nutzt plakative Mittel, um den Horror von Geschlechterrollen und Schönheitsidealen als Bodyhorror zu inszenieren. Insbesondere wird die Industrie karikiert und vorgeführt, die (weibliche) Schönheit und Gesundheit vermarktet. Ironischerweise eine männergemachte Industrie. Das Resultat: dass Frauen sich selbst geißeln, sich seelisch und körperlich schaden und am Ende: sich gegenseitig Feindin werden. Coralie Fargeat gelingt es immer wieder schmerzhaft realistische Textzeilen und Metaphern in dem Film hochkochen zu lassen und zu zeigen, was das mit weiblichem Selbstwertgefühl macht. Die Mittel dazu sind Geschmackssache wie in kaum einem anderen Film: brutal bis ekelhaft oder grotesk. Realistisch v.A. dank der Prosthetics. Gegen Ende stellt sich dennoch ein gewisses „Wir haben schon verstanden“-Gefühl ein, wenn immer noch eins auf den Ekelfaktor und die Grotesquerie drauf gesetzt wird. Und das so sehr, dass es den vorherigen Pointenreichtum ein Stück weit vergessen macht.
The Substance, UK/USA/Frankreich, 2024, Coralie Fargeat, 141 min, (7/10)

Normalerweise genieße ich es Ende des Jahres und anfangs des darauffolgenden die mit Awards überhäuften Filme zu schauen und mir im Kino selber ein Bild von denen zu machen. Aus privaten Gründen habe ich das aber 2024/2025 nicht getan und ja, ein bisschen schade finde ich das schon. Aber meine privaten Gründe sind zu gut, um wirklich traurig zu sein. 😉 Außerdem bin ich etwas negativ überrascht, dass sich die großen Kategorien und Trophäen dann doch auf die immergleichen Filme verteilen. Oder in anderen Worten: ich halte das nicht für den stärksten Jahrgang. Was ich cool finde: dass mit Emilia Pérez ein Film mehrfach nominiert ist, der eine queere Person zentriert und dass Horrorfilme geehrt werden („Nosferatu“, „The Substance“). Auch wenn ich gestehen muss, dass ich „The Substance“ da nun nicht wirklich gesehen hätte, obwohl mir der Film gefiel. Welchen Filmen rechnet ihr Chancen aus?
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
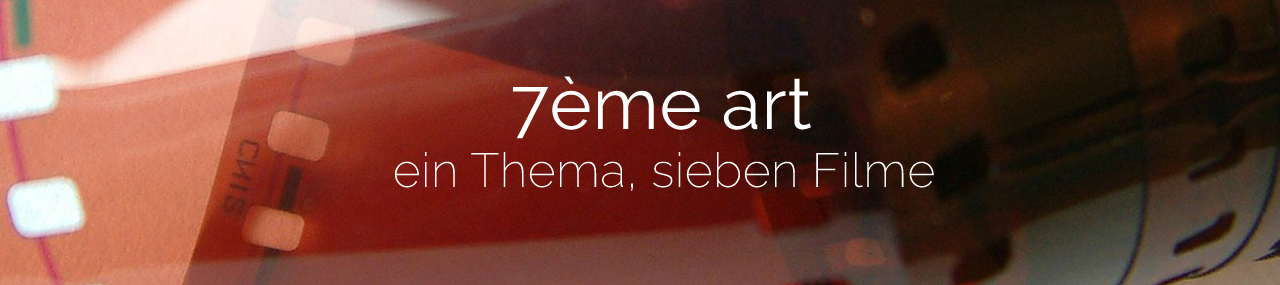
Schreibe einen Kommentar