Am 27. März 2022 werden die 94. Academy Awards verliehen. Man kann die Oscars hassen, auslassen, ignorieren, mögen, ihnen entgegenfiebern. Ich hype die Veranstaltung nicht mehr so wie als Teenager, als ich für meine Lieblingsfilme und -darsteller*innen mitgefiebert habe. Aber diese 5-Minuten extra Ruhm für gute Filme und visionäre Filmschaffende mag ich, ärgere mich aber auch über die Filter und Snubs der Oscars. Noch finde ich es spannend zu schauen, was bei der wohl bekanntesten Filmpreisverleihung bedacht wird. Die Tradition nominierte Filme innerhalb von 7ème art zu besprechen und vorher zu fachsimpeln, was wohl abräumt, feiert jedenfalls bald Jubiläum. Angefangen damit habe ich im Blog 2013. Und auch heute setze ich die Tradition fort mit sieben Filmen, die in diesem Jahr für einen Oscar nominiert sind.
Belfast
Kenneth Branaghs autobiografisch geprägter Film nimmt uns mit in das Belfast der 1960er Jahre. Mitten rein in den Nordirlandkonflikt. Es sind nicht nur die gewalltätigen Unruhen zwischen Protestanten und Katholiken, sondern auch der doppelte Boden aus Interessen rund um die Frage: zu wem gehört Nordirland? Mittendrin ist da der neunjährige Buddy (Jude Hill), der die meiste Zeit mit seinem Bruder Will (Lewis McAskie) und seiner „Ma“ (Caitriona Balfe) alleine ist, weil „Pa“ (Jamie Dornan) in England arbeitet. Für Buddy ist die Welt eigentlich ganz in Ordnung. Vor Allem, wenn er in der Schule in der Nähe der hübschen Catherine (Olive Tennant) sitzen darf und mit seinen Eltern und Großelten (Ciarán Hinds, Judi Dench) Kinofilme schauen kann. Wenn da nicht die Unruhen wären.
„Belfast | Offizieller Trailer #2 deutsch/german HD“, via Universal Pictures Germany (Youtube)
Belfast wird allerdings nicht nur durch die Augen Buddys erzählt. Auch die Beziehung seiner Eltern spielt eine große Rolle und vor Allem die Frage, wo man seinen Moralkompass ansetzt in einer Zeit wie dieser. Was das betrifft, tut der Film an einigen Stellen besonders jetzt sehr weh, wo sich „Geschwisterstaaten“ oder „Nachbarstaaten“ gegenseitig erschießen. Die Szenen Belfasts, in denen es zu brutalen Ausschreitungen kommt, mögen kurz sein, haben es aber in sich. Da werden Steine geschmissen und Autos angezündet, vollkommen egal, ob „Ma“ mit Buddy im Arm durch die Straße rennt, um sie beide in Sicherheit zu bringen. Ein starker Kontrast dazu ist die Perspektive des herrlich gutmütigen Buddys, der den Konflikt nicht versteht und zu Recht hinterfragt, was denn so anders an Protestanten oder Katholiken sein soll. Eine der besten Szenen war für mich als Buddy angestiftet wird die Unruhen auszunutzen, um einen Supermarkt zu plünden und er solle nehmen, „was er braucht“. Seine herrlich bodenständige Wahl zeugt davon was solche Konflikte oftmals an sich haben. Denn während die über Jahre zündeln, können sie längst nicht mehr von allen komplett durchdrungen werden. Moral verwischt und in deren Mitte stehen Kinder, die „mitmachen müssen“ und manchmal vielleicht einfach nur tun, was man ihnen sagt.
Kenneth Branagh schafft es mit der Konzentration auf die Szenen einer Kindheit den Film nie zu hart zu machen. Irritierend dürfte für viele Zuschauende sogar sein wie lustig der Film oder wie glücklich Buddys Kindheit wirkt. Ist sie das aber? Vor Allem sind es Filme und Momente des Eskapismus, die im Gegensatz zum Rest des Films nicht Schwarzweiß, sondern in Farbe dargestellt werden. Vielleicht ist es mehr ein bittersüßer Rückblick Branaghs auf eine Kindheit, die glücklich ist, weil Buddy eine liebevolle Familie hat und sich damals der Schwere des Verlusts der Heimat noch nicht bewusst sein konnte. Die Kameraarbeit des Zyprers Haris Zambarloukos ist durch viele Close-Ups auf Gesichter, Hinaufsichten auf die Erwachsenen und Totalen geprägt, die unterschwellig aufzeichnen welche „Schwere“ der Moment hat. Es wundert mich eigentlich, dass er nicht für einen Oscar nominiert ist. Untermalt wird das was wir in Belfast sehen von Van Morrisons Musik und das scheint der perfekte (teils Saxophon-geschwängerte) Soundtrack für die Nostalgie Belfasts zu sein. So schafft der Film ein sehr sympathisches und nostalgisches Portrait eines Arbeiterviertels, einer Kindheit im Nordirland der 60er und vor Allem der Herzen brechenden Frage: ab wann weiß man, dass man seine Heimat verlassen muss?
Belfast, UK, 2021, Kenneth Branagh, 99 min, (8/10)

„DON’T LOOK UP | Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence | Official Trailer | Netflix“, via Netflix (Youtube)
Don’t Look Up
Ja, kein Quatsch – ein „Film für unsere Zeit“. Wäre Don’t Look Up fünf Jahre frührer schienen, dann hätten wir den möglicherweise für Trash gehalten und trotz des Bemühens um ein wenig professionelle Distanz und Objektivität, hätte er sicherlich ein paar Punkte weniger kassiert. Vielleicht hätten wir sogar gesagt „So ein Bödsinn. So borniert sind wir Menschen doch nicht.“ Wenn uns Klimakrise und Pandemie eins gelehrt haben, dann: doch, doch. Don’t Look Up handelt von der Doktorandin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), die einen Kometen entdeckt und zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) zu einer erschütternden Erkenntnis kommt: der Komet wird die Erde treffen und zerstören. Als sie die verheerende Information weitergeben, werden sie mit korrupten Politiker*innen und Wissenschaftsleugnung konfrontiert, sowie der Rolle der Medien, was die Rezeption von Informationen betrifft. Irgendwann heißt es seitens der Wissenschaftler: bitte glaubt uns! Schaut nach oben, wenn ihr uns nicht glaubt! Seitens der Wissenschaftsleugnenden: „Don’t Look Up!“
Don’t Look Up ist kein guter Film. Aber er hat eine gute und leider absolut zeitgeistige Botschaft. Warum ist er kein guter Film? Weil er einfach inflationär Nutzung von Stockphotos und -videos macht, die wenig Bezug zur Handlung haben außer die „Welt etwas größer zu machen“ und Emotionalität aufzubauen, wo es keiner weiteren bedarf. Zumindest nicht, da der Film im Jahr 2021 veröffentlicht wurde und dessen Inhalte jeden betreffen. Obwohl die Botschaft des Films klar ist, geht er in Überlänge über. Ein Herunterdrosseln der Figuren hätte der Botschaft nicht geschadet und den Film weniger verwässert. Man muss sich auch die Frage stellen, ob es das Aufgreifen sovieler Elemente gebraucht hätte. Klar bin ich dankbar dafür, dass die Schere zwischen Wahrnehmung weiblicher und männlicher Personen des öffentlichen Lebens angesprochen wird. Während die Wissenschaftlerin als hysterisch abgetan wird, avanciert der männliche Wissenschaftler zum Sexsymbol, obwohl zum Schweigen verdammtes Instrument der Medien. Obwohl der Film einfach zu voll ist, über „gutes Handwerk“ aber keine filmischen Rafinessen verfügt, hat er erzählerische. Die Satire ist so allumfassend und ein Portrait unserer Weltpolitik, Tech-Giganten, Wissenschaftswahrnehmung, Medien, allem, dass es wie eine Karikatur wirken müsste, wäre es nicht so wahr.
Don’t Look Up, USA, 2021, Adam McKay, 138 min, (8/10)

Drive My Car
Der Schauspieler Yūsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) wird beauftragt in Hiroshima das Theaterstück Onkel Wanja von Anton Tschechow zu inszenieren. Das Festival stellt ihm eine Fahrerin, was er anfangs ablehnt. Er will selber fahren, da er Routinen hat, die eigenartig wirken könnten. Sein tomatenroter Saab turbo ist außerdem mit vielen Erinnerungen behaftet. Nach einer Probefahrt stimmt er aber dennoch zu. Seine Fahrerin Misaki Watari (Tōko Miura) spricht nicht viel und fährt gut. Sie kommentiert auch die Dramen, die sich auf der Rückbank oder abseits der Bühne abspielen nur sehr nüchtern oder gar nicht. Like a pro. Denn während alle annehmen, dass Kafuku selber bei dem Stück die Titelrolle des Wanja spielen würde, castet er den jüngeren Darsteller Kōji Takatsuki (Masaki Okada). Die wenigstens wissen, dass die Zwei sich schon mal gesehen haben. Takatsuki hatte eine Affäre mit Kafukus vor wenigen Jahren verstorbener Frau Oto (Reika Kirishima).
Trotz drei Stunden Spielzeit schrammt Drive My Car durch schiere Filmkunst an dem Schicksal des Labels „langweilig“ vorbei. Einen großen Teil daran hat die unaufgeregte Inszenierung, die durch Denkpausen für die Zuschauenden lebt. Und wir haben einiges zu verarbeiten. Wie wir aus dem 30 Minuten langen(!) Vorspann erfahren, hat Kafuku seine Frau Oto einst zusammen mit Takatsuki erwischt. Kurz darauf stirbt Oto und Kafuku hat nie den Mut aufgebracht sie zu fragen, warum sie ihn betrügt. Eine verpasste Frage, eine gefürchtete Antwort, die Folge dramatisch – und Gegenstand von Kafukus Leben und des Films. In den weiteren Etappen erleben wir Kafuku und die Theatertruppe in Hiroshima, das Kennenlernen mit seiner Fahrerin und deren Geschichte. Denn auch Misaki hat eine Vergangenheit, in deren Zentrum unbeantwortete Fragen und Verlust stehen. Die Auseinandersetzung ist ein Versprechen auf Katharsis für Kafuku und Misaki.
„DRIVE MY CAR Trailer German Deutsch UT (2021)“, via KinoCheck Indie (Youtube)
Dabei bleibt Drive my Car sogar der Vorlage Haruki Murakamis treu und lässt die Tür offen für Parallelen zu magischem Realismus oder Surrealismus. Wir erfahren, dass Misaki nie ihren Vater kennenlernte und zufälligerweise im selben Alter ist wie Kafukus einst verstorbene Tochter jetzt wäre. Das kann schon fast kein Zufall sein. In einer anderen Welt wären sie vielleicht Vater und Tochter. Der Umstand ist sehr Murakami. Ebenso die stillen Übereinkünfte zwischen den Figuren. Selbst die Wirkung der Arbeit am Theaterstück und das Theaterstück selber haben eine spannende Anziehung. Ich würde es sofort anschauen in der Form wie Kafuku es inszeniert. Das alles wird vor Hiroshima inszeniert, aber nicht dem Ort als Tourismusmagnet und Kriegsmahnmal. Ryūsuke Hamaguchi wählte Kulissen abseits all dem. Klar ist trotz all dem aber auch: wer sich schnell langweilt, hat hier vielleicht trotz all des erzählerischen Zaubers ein Problem. Die größere Kritik ist für mich eher, dass der Film sehr männlich geprägt ist (auch das ist leider sehr Murakami) und Misaki etwas zu kurz zu kommen scheint. Nichtsdesto trotz ist Drive My Car ein faszinierend choreografierter Film. Ein Ort, ein bestimmter Zeitpunkt, Aufeinandertreffen von Personen, die sich ohne das Theaterstück nie begegnet wären, machen, dass es klickt und sich Kafuku der Verarbeitung seiner Trauer stellen muss. Wie alles ineinandergreift, berührt und fasziniert ungemein. Und das ohne Holzhammer, sondern auf stille und wunderschöne Art.
Drive My Car (OT: ドライブ・マイ・カー), Japan, 2021, Ryūsuke Hamaguchi, 179 min, (9/10)

Frau im Dunkeln
Als dann erstmal die amerikanisch-griechische Großfamilie lärmend und rüpelhaft auf dem Strand aufschlägt, ist der Professorin Leda (Olivia Colman) klar, dass der Urlaub (oder „Arbeitsurlaub“) gelaufen ist. Der Anblick der jungen Mutter Nina (Dakota Johnson) und ihrer kleinen Tochter weckt allerdings in Leda Erinnerungen an die Zeit mir ihren Töchtern. Nina scheint wie ein Spiegelbild von Ledas jüngerem selbst zu sein. Ab und zu auf sich gestellt, der Mann unterwegs, sein Leben lebend, das Kind aufmerksamkeitsbedürftig und kräftezehrend. Denkt Leda an sich und ihre Töchter zurück, dann hört sie vor Allem quengeln, Schreie, Dramen, wie an allen Enden an ihr gezerrt wird, während sie versucht zu arbeiten und voranzukommen. Zwischen Nina und Leda entsteht eine distanzierte, schwierige „Gegenabhängigkeit“.
„Frau im Dunkeln | Offizieller Trailer | Netflix“, via Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz (Youtube)
Maggie Gyllenhaals Adaption von Elena Ferrantes Roman La figlia oscura ist ihr erster Spielfilm und sie zu Recht für das adaptierte Drehbuch für einen Oscar nominiert. Sie versteht show, don’t tell, denn Frau im Dunkeln gibt einem einiges zum Nachdenken mit auf den Weg. Lange Zeit ist nicht klar, warum Nina und ihre Tochter so eine Schwere in Leda auslösen und man geht vom schlimmsten aus. Ist eine von Ledas Töchtern unter ihrer Aufsicht gestorben? Was ist passiert? Tatsächlich werden viele bruchstückhafte Paralleln Ninas und Ledas nebeneinander gehalten, die Mutterschaft oder Elternschaft nicht gerade positiv bewerben.
In Leda wachsen jedenfalls heftige Schuldgefühle, dass sie eine schlechte Mutter war und fördern eine schwierige und vielleicht sogar gefährliche Beziehung zwischen Leda und der ominösen Großfamilie, „die man besser nicht verärgert“. Dabei ist Leda Personifikation des unfairen und überholten gesellschaftlichen Bildes, dass eine Frau ihre „Rolle“ nur erfüllt, wenn sie ein Mutter ist. Mehr als das: eine „gute“ Mutter. Will man werten, dann ist Leda offenbar eine bessere Wissenschaftlerin als Mutter. Ist das weniger wert? Liebt sie ihre Töchter deswegen weniger? Das ist nicht einfach und resultiert in vielen Handlungen der erwachsenen Leda, die vielleicht ein bisschen zu sehr „show“ und zu wenig „tell“ sind. Letzten Endes werden vermutlich viele Zuschauende Leda als irrational abstempeln und sagen „ich verstehe nicht, warum sie das gemacht hat“ und den Film nicht mögen. Tatsächlich fühlt sich Frau im Dunkeln aber gerade wegen der unterschwelligen Gefahr und noch nicht beantworteten Fragen wie eine Mischung aus Krimi und Drama an, die einige spannende Fragen zu unserer Wahrnehmung des Gezeigten stellt.
Frau im Dunkeln (OT: The Lost Daughter), Griechenland/USA/UK/Israel, 2021, Maggie Gyllenhaal, 122 min, (7/10)

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
Nachdem sich James Bond (Daniel Craig) mit Madeleine Swann (Léa Seydoux) zur Ruhe gesetzt hat, jetten sie zusammen durch die Welt. Aber über beiden scheint ein Schatten zu hängen. Während Madeleine Erinnerungen an ihre Kindheit nachhängt, kann James nicht aufhören sich in Erwartung eines Angriffs über die Schulter zu schauen. Tatsächlich wird auf ihn ein Anschlag verübt und es scheint nur eine Antwort zu geben, wer ihn verraten hat. Sein Vertrauen in Madeleine ist zerstört und er trennt sich von ihr. James Neustart wirkt wie ein falsches Versprechen. In die Bitterkeit mischt sich die Nachricht, dass die Welt ohne es zu wissen von einer Herakles genannten Biowaffe bedroht wird. Als Felix Leiter (Jeffrey Wright) auf Bonds Türschwelle steht, lässt er sich dazu hinreißen dem Fall nachzugehen. Soviel macht Leiter allerdings klar: dieses Mal ermittelt Bond höchstwahrscheinlich für die CIA, aber gegen das MI6 und M (Ralph Fiennes), die in die Entwicklung von Herakles involviert sind. Spätestens als sich die Agentin Nomi (Lashana Lynch) als (neue) 007 vorstellt und ihm klar macht, dass sie nun auf verschiedenen Seiten stehen und dass wohl doch nicht alles beim Alten ist.
Das Gute vorweg. Cary Joji Fukunagas „Bond“ ist eine Augenweide. Die Bilder sind symbolträchtig und metaphorisch. Masken, Spuren der Vergangenheit, gefallene Titanen und exotische Schauplätze kommen in bester Bond-Manier zusammen. In punkto Diversität hat der Film die Reihe angenehm und noch deutlicher als in der Vergangenheit fortgesetzt. Ich denke da vorrangig an Q (Ben Whishaw) und Lashana Lynch als neue 007, auch wenn das wesentlich konsequenter hätte sein können. Das Problem ist nur, dass das Bemühen allen Eventualitäten vorauszueilen und alle Wünsche von „Bond 25“ vorwegzunehmen dem Film definitiv nicht gut getan hat. Alles was die neuen Bondfilme etabliert haben, übertreiben sie so weit und mischen es so krampfhaft mit alten, typischen Bond-Motiven, dass man Bond 25 noch schwerlich als Bondfilm erkennt, weil er schlichtweg so überfrachtet ist. Ein Beispiel? Der viel zu kurze Auftritt von Ana de Armas Modernisierung des Bondgirls, das schlagkräftig, schön, witzig und an Bond null interessiert ist. Als zweieinhalb-stündiges Monstrum versucht der Film so ziemlich alles mit zu erschlagen, was geht. Inklusive Blofeld (Christoph Waltz). Dadurch wirken viel zuviele Szenen und Chancen verschenkt und können in der Kürze nicht überzeugen. Leider demonstriert No Time To Die, woran schon Spectre gescheitert ist. Dass das Zusammenbringen alter und neuer Werte ein Unterfangen ist, wofür es viel Fingerspitzengefühl und nicht nur Production Value und „Masse“ an Ideen braucht.
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (OT: No Time to Die), UK/USA, 2021, Cary Joji Fukunaga, 163 min, (6/10)

Macbeth
Der Aberglaube besagt, dass man es nur „The Scottish Play“ nennen soll. Aberglaube und Vorhersage haben ihm aber auch nicht gut getan. Macbeth (Denzel Washington) hat eben noch im Krieg an der Seite seines Königs Duncan (Brendan Gleeson) gekämpft, da begegnet er den drei Hexen (Kathryn Hunter) und bekommt eine Weissagung, die alles verändert. Sie sagen er wird der König Schottlands. Er glaubt ihnen nicht. Aber sie machen noch mehr Vorhersagen. Als die erste davon eintritt, ist die Aussicht auf den Thron wie ein Gift, dass sich in ihm, v.A. aber auch in Lady Macbeth (Frances McDormand) ausbreitet und nicht mehr loslässt. Bis Macbeth den König kurzerhand selbst umbringt. Der Rest ist Geschichte.
Zumindest fühlt es sich so an. Denn selbst wenn wir Macbeth nicht gelesen haben, kennen wir doch die Figuren oder bekannte Sätze. Ich denke da nur an „Something wicked this way comes“ oder „When shall we three meet again/In thunder, lightning, or in rain?“ Hier großartig vorgetragen von Kathryn Hunter als alle drei Hexen bzw „Weird Sisters“. Schicksalhaftigkeit ist das große Thema Macbeths. Die Unausweichlichkeit der Prophezeiung, aber auch Doppelbödigkeit und wie sie die Ambition und den Moralkompass vergiftet. Macbeth ist an sich ein kleines, in sich verschränktes, perfektes Paket. Aber mit den Darstellern und der optischen Inszenierung in Joel Coens Macbeth nochmal umso krasser. Denzel Washington und Frances McDormand spielen ohne Pathos und drücken stattdessen Kalkül, Machtlosigkeit und Angst aus – sie sind so gut dabei! Ungestelzt, natürlich und trotzdem ausdrucksstark. Das überweltliche überlassen sie Theatergröße Kathryn Hunter, die ihr inneres Das siebente Siegel channelt. Joel Coen zeichnet sich zusammen mit Lucian Johnston selber für den Schnitt verantwortlich. In Kombination mit der Kameraarbeit Bruno Delbonnels entsteht ein nahezu quadratischer Traum in Schwarzweiß, der viel mit geometrischen Figuren und Licht und Schatten arbeitet. Gute Metapher – die Reduktion auf das Wesentliche, das Verschwimmen der Grenzen zwischen Gute und Böse. Nur manche Übergänge könnten weniger hart sein wie der Verfall Lady MacBeths, der sehr plötzlich kommt.
Macbeth (OT: The Tragedy of Macbeth), USA, 2021, Joel Coen, 105 min, (8/10)

„The Power of the Dog | Official Teaser | Netflix“, via Netflix (Youtube)
The Power of the Dog
Jane Campions bisher teuerster Film ist eine Adaption von Thomas Savages gleichnamigem Roman. Und sowohl in Bedeutung als auch Bildern eine Wucht. Die ungleichen Brüder Phil (Benedict Cumberbatch) und George Burbank (Jesse Plemons) führen eine Ranch im Montana der 1920er Jahre. Phil ist der Inbegriff eines Cowboys, macht auch mal die Drecksarbeit und gibt einen barschen Ton an. Vor Allem all jenen gegenüber, die nicht seinem Weltbild „markiger Männer“ entsprechen. Das tut sein Bruder George eigentlich auch nicht. Er ist ruhig, zurückhaltend und wirkt zwischen den Cowboys deplatziert. Phils Boshaftigkeit geht soweit, dass er seinen Bruder „Fatso“ nennt, aber bei allem Übel wenigstens nicht darüber hinaus. Stattdessen will er ihn zwingend in alles einbeziehen und in seiner Nähe halten. Das bleibt nicht so als sich George in die Witwe Rose (Kirsten Dunst) verliebt und sie heiratet. Als Rose und deren Sohn Peter (Kodi Smit-McPhee) einziehen, betreibt Phil seine Schikane systematisch und droht die Familie zugrunde zu richten.
Zumindest spürt man förmlich wie allen ein übles Ende droht. Benedict Cumberbatch ist großartig darin diese feindselige Atmosphäre zu erzeugen, bei der man meint die Luft mit einem Messer schneiden zu können. Nichts anderes haben wir von ihm erwartet, denn Charakterrollen waren natürlich schon immer seine Stärke. Jetzt darf er auch mal richtig gemein sein. In der Figur Phils gelingt es ihm aber v.A. spielend uns hinter die harte Schale blicken zu lassen und diese als Schutzwall zu erkennen, die Homosexualität hinter Homophobie versteckt. The Power of the Dog demonstriert wie das Verneinen des Selbst zu absoluter Zerstörung führt. Dank des großartigen Ensembles demonstrieren das auch alle Charaktere bis in die Nebenrollen. Kirsten Dunst ist verdient nominiert, Jesse Plemons legt genau die richtige Hemdsärmeligkeit des unbeholfenen, aber ausweglosen George an den Tag. Sie beide teilen nicht nur eine hinreißende Szene. Die ruhige Landschaft Neuseelands mag nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht in Montana gedreht wurde, begeistert aber auch als Western-Schauplatz und steht im krassen Gegensatz zu dem menschlichen Drama, dass sich davor abspielt.
The Power of the Dog, Neuseeland/Australien, 2021, Jane Campion, 128 min, (9/10)

Ja wie man sieht ist alles dabei. Filme, bei denen ich so gar nicht sehe, warum sie nominiert sind („No Time To Die“, „Don’t Look Up!“) und welche, die ich selber auch sehr feiere. Andere will ich nicht mal im Kino schauen wie „King Richard“ oder „Nightmare Alley“ … . Wer „Dune“ vermisst, findet den übrigens hier. Vielleicht schaue ich noch ein paar mehr, da man einige entweder noch im Kino oder auf den Streamingplattformen erwischen kann. „Frau im Dunkeln“ könnt ihr beispielsweise auf Netflix schauen, „Belfast“ gerade noch im Kino, „Macbeth“ beim Konzern mit dem angebissenen Apfel. Mich interessiert noch u.a. „Being the Ricardos“ und „Die Mitchells gegen die Maschinen“. „Licorice Pizza“ fesselt mich trotz der guten Kritiken nicht so besonders und mein Nicht-Aufsuchen des Kinos ist eine Mischung aus kein Interesse und „verpasst“. Welchen denkt ihr sollte man noch unbedingt gesehen haben? Welchen kann man auslassen? Eigentlich hätte ich anlässlich des Women History Month ganz gern eine Werkschau der Filme einer Regisseurin gemacht. Aber andererseits sollte jeder Monat den Frauen mindestens so sehr wie den Männern mindest so sehr wie Nicht-Binären Personen gehören. Also denke ich, verkrafte ich es, das auf den April zu schieben.
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
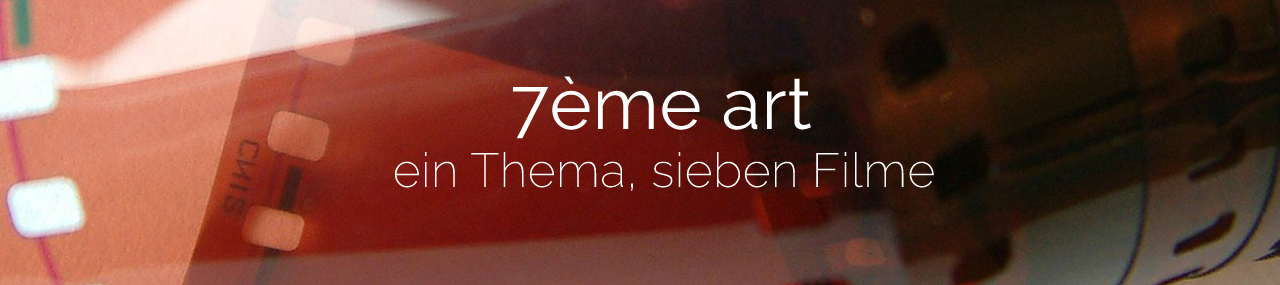
Schreibe einen Kommentar