Die Coen Brothers. Das sind die, die Oscars gewinnen. Die, die gerne unter mal unter dem Pseudonym Roderick Jaynes den Schnitt übernehmen. Das sind die, in deren Filme oftmals ein korpulenter Typ stirbt. Und vor Allem sind es die, mit den Filmenden, die verdammt viele Fragen offen lassen. Außer Frage steht aber, dass sie Visionäre sind, deren Filme sich selten in ein Genre quetschen lassen und die ihr Handwerk insofern verstehen, dass Szenengestaltung, Schnitt und Drehbuchkniffe großartig und oftmals subtil Botschaft und Handlung unterstreichen. Aber ich muss gestehen: ich konnte nicht immer soviel mit ihnen und ihren Filmen anfangen wie jetzt. Werkschauen beheben sowas, sagt man. Der gemeinsame Nenner der heutigen Filme ist: es sind Filme, bei denen die Coen Brüder Regie führten.
„Barton Fink (1991) – Original Theatrical Trailer“, via spamanator666 (Youtube)
Barton Fink
Hollywood is calling. Barton Fink (John Turturro) hat als Autor jüngst seinen Durchbruch mit einem Stück am Broadway gefeiert, da klopft Hollywood an und zitiert ihn nach L.A. für ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Anfangs hadert er voller Idealismus und ist sich uneins, ob das der richtige Weg für ihn ist. Letzten Endes sitzt er doch vor dem Studioboss und erfährt, dass er ein Drehbuch über einen Wrestler entwickeln soll. In seiner gammligen Absteige, dem verlassen wirkenden Hotel Earle, versucht Fink nun also Tag für Tag sich hinter die Schreibmaschine zu setzen und etwas zu entwickeln. Mal sind es die Geräusche aus dem Nachbarzimmer, die ihn ablenken, mal sein gutmütiger Zimmernachbar Charlie Meadows (John Goodman), mal die trunkene High-Society bestehend aus bereits von L.A. aufgerauchter Schreiberlinge. Aber die Uhr tickt.
Barton Fink vereint so viele Motive, dass man eigentlich alleine darüber ellenlange Artikel schreiben könnte. Gegen Ende wird der Film auch deutlich surrealistisch und ein wenig hermetisch – das gibt viel Raum für Interpretation. Barton Fink als Figur steht im Zentrum dessen als ein Beispiel für einen Künstler, einen Kreativen, der seine Funktion in der Welt für besonders hält und der Meinung ist einer Berufung zu folgen. Mit Herzblut aber immerhin. So fällt die Arroganz Barton Finks weniger ins Gewicht. Er ist eigentlich so arrogant, dass er denjenigen, dessen Geschichten er aufschreibt („die einfachen Leute“) nicht mal zuhört, wenn sie ihm aus ihrem einfachen Leben erzählen wollen (siehe Szenen mit John Goodman und dessen gewaltiger Monolog gegen Ende – sinngemäß „You are just a tourist with a typewriter. I have to live here“). Aber durch Finks Überzeugung leiden wir bereitweillig als Zuschauer mit ihm, wenn ihm Hollywood im wahrsten Sinne des Wortes im einen Moment die Füße küsst und im nächsten sticht und tritt. Damit hält der Film einerseits dem idealistisch-arroganten Künstlertyp den Spiegel vor und schafft trotzdem den Spagat einen trotz Allem sympathisch-menschlichen Hauptcharakter (Turturro sei Dank) zu zeigen. Ansonsten hätte der Film möglicherweise nicht funktioniert und nicht so berührt wie er es tut. Andererseits zeigt er die Banalität der Traumfabrik und dessen, was sie an „Träumen“ webt. Für die Geschichte die Fink schreiben soll („Es geht um einen Wrestler“), sieht der Produzent bzw. Studioboss nur zwei (gängige) Optionen. „Also entweder ist der Wrestler Waise … oder er will diese eine Frau.“ Tiefsinnig. Wie im echten Leben. Aber letztendlich ist alles vielleicht so un-wahr wie Filme. Mit Barton Fink haben die Coen Brüder die Widersprüchlichkeit als filmisches Element geboren möchte man sagen.
Barton Fink, USA/UK, 1991, Joel Coen/Ethan Coen, 116 min, (9/10)

Fargo
Autoverkäufer Jerry Lundegaard (William H. Macy) hat Geldsorgen und denkt er hat den perfekten Plan, um diese loszuwerden. Er will seine Frau Jean (Kristin Rudrüd) von ein paar Kleinkriminellen kidnappen lassen und mit ihnen das Lösegeld des stinkreichen Schwiegervaters teilen. Über Dritte lernt er die Gauner Carl Showalter (Steve Buscemi) und Gaear Grimsrud (Peter Stormare) kennen und erklärt ihnen den Plan. Vor Allem erklärt er, müsse alles ganz ohne Gewalt ablaufen. Schon als er nach dem Fake-Kidnap die verwüstete Wohnung sieht, müsste ihm klar geworden sein, dass das nicht geklappt hat. Als dann klar wird, dass der schweigsame Grimsrud und der weniger schweigsame Showalter schon am ersten Tag drei Tote zu verantworten haben (denn besonders schlau stellen sie sich nicht an), kann man schon nicht mehr von „nach Plan“ sprechen. Im Fall der drei Mordopfer ermittelt die schwangere Polizistin Marge Gunderson (Frances McDormand).
Und die wunderbare Ironie der Geschichte liegt darin, dass Marge in dieser Welt voller angeblich kerniger Männer, so ziemlich die einzige ist, die was hinkriegt, die richtigen Spuren identifiziert und mit einer beneidenswerten Gelassenheit agiert. Denn wie so oft in Filmen der Coen-Brüder ist die Umwelt voll von Allem, was das Leben zu bieten hat. Folgenschweren Zufällen und Plänen, die total nach hinten losgehen, irren Dialogen fern jeglicher Logik und den kleinen Tücken des Lebens. Auch macht er sich sowohl über geldgierige Halsabschneider lustig, als auch über Ganoven und Kleinstadtpolizisten. Was anfangs somit beschwingt beginnt, wird ziemlich schnell ernster als man es sich hätte träumen lassen und kostet doch noch so viele Menschenleben, dass der Film ein bisschen Bitterkeit verursacht. Dafür aber einen Kniff hat: bei all dem stellt er das kleinstädtische und anfangs als naiv gekennzeichnete Leben später als eines dar, dass sich mehr lohnt als der große Coup. Mit Fargo legten die Coen-Brüder den Grundstein für ihren Ruf und üblichen Schabernack. Denn der Film basiert anders als anfangs angegeben nicht auf wahren Begebenheiten und spielt auch eher wenig in Fargo, North Dakota. 🙂
Fargo, USA/UK, 1996, Joel Coen, 98 min, (8/10)

The Big Lebowski
Als ein Schlägertrupp in seine Wohnung einbricht, ihn in seine eigene Toilette taucht und auf seinen Teppich pinkelt, ist das kein gewöhnlicher Tag für den Dude (Jeff Bridges). Und womit hat er das verdient? Lediglich, weil er zufällig auch Jeff Lebowski heißt, denn die Schläger haben den falschen erwischt. Als er den Jeff Lebowski trifft, dem die Abrechnung eigentlich angedacht war, tritt das eine Welle an Ereignissen los, die ihn zum Schluss zum Mittelsmann bei einer Entführung machen, er hat eventuell eine Frau auf dem Gewissen und eine Millionen gewonnen und verloren und ihm wird nach dem Leben getrachtet. Tough day. In Nebenrollen sind John Goodman als Walter Sobchak und Steve Buscemi als Donny, zwei Freunde des Dudes, zu sehen, die seine Lage eher nicht verbessern und Julianne Moore als Maude Lebowski mit einer wunderbar spitzen Verballhornung auf Künstler und Feministinnen des Frontal-Kollisionskurs-Levels. Aber die wohl besten Nebenrollen spielen Bowling und White Russians. Übrigens ist ein White Russian Lebowski-Style dem Film entnommen, da den Dude den mit Milch statt Sahne macht. Prost.
„The Big Lebowski“ Official Trailer“, via PictureBox (Youtube)
Das Ziel der Coen-Brüder war es eine verzwickte Handlung zu stricken, der es nicht einfach ist zu folgen, die aber letzten Endes komplett nichtig wird. Eine Hommage an die kleinen oder größeren Probleme des Lebens, die uns sicherlich im Moment beschäftigen oder wie das Ende der Welt wirken, aber mit ein bisschen gechillter Dudeheit wüssten wir schon früher: es geht schon vorbei. Dabei ist The Big Lebowski eine Hommage an das klassische „Film noir“-Kino der 40er Jahre, in dem normalerweise ein cooler Privatdetektiv ermittelt. Hier ist es mehr oder weniger der Dude, der das tut – oder sowas in der Art. Denn eigentlich kommt der Fall zu ihm, inklusive diverser Schlägertruppen, Geld (wie gewonnen so zerronnen) und anderem Unheil. Den Kniff einen lässigen Detektiv mit dem verlottert-lässigen Dude zu ersetzen ist genial, aber es ist auch kein Wunder, wenn man diese Hommage übersieht – sie ist nämlich nicht besonders offensichtlich. The Big Lebowski ist einer der Filme, der erst nach seiner Veröffentlichung für das Heimkino Kultstatus erlangte. Der Umstand, dass der arbeitslose Dude, der sein Leben chillt und sein Leben auch so perfekt findet, hier als Held auftritt, trägt sicherlich seinen Teil dazu bei. Interessant ist, dass er in dem Film von diversen Charakteren als Sozialschmarotzer dargestellt wird, der sich einen Job suchen will, aber über den man eher sehr wenig weiß. Alles prasselt eben irgendwie auf den Dude ein, ohne dass er viel dazu beitragen muss. Zu Beginn ist ja alleine sein Name der Aufhänger für das Geschehen des Films. Entgegen gesetzt zu seinen Lebensumständen und Vorurteilen gegen ihn ist er sogar was seinen Kumpel Walter betrifft, die Stimme der Vernunft. Und wenn man ihn dann zu Walgesängen und bei Kerzenschein in der Badewanne liegen sieht, dann sagt man sich durchaus: ich brauche auch etwas mehr Dudeness in meinem Leben.
The Big Lebowski, USA/UK, 1998, Joel & Ethan Coen, 117 min, (9/10)

The Man Who Wasn’t There
Ed Crane (Billy Bob Thornton) arbeitet seit Jahren als Friseur, fristet ein und denselben eintönigen Alltag und kehrt abends zu seiner Frau Doris (Frances McDormand) zurück, von der er längst weiß, dass sie eine Affäre mit ihrem Chef „Big Dave“ (James Gandolfini) hat. Als der Handelsreisende Creighton Tolliver (Jon Polito) in den Laden hereinschneit und von einer neuen Geschäftsidee spricht für die er Partner sucht, sieht Ed seine Chance gekommen um seinem alten Leben zu entfliehen. Er will Big Dave erpressen und damit das nötige Kleingeld auftreiben. Gedacht, gesagt, getan. Der Beginn der Katastrophe, denn alles läuft anders als Ed es geplant hat. Als Hommage an depressives Kino-Noir der 40er Jahre ist der Schwarzweißfilm stimmig. Licht- und Schattenspiel setzt das Dilemma Cranes in das richtige (Zwie)Licht. Wäre der ursprünglich in bunt gedrehte Film auch in bunt in die Kinos gekommen, hätte er mit Sicherheit an Wirkung verloren. Die Story (nach einem Drehbuch von Ethan und Joel Coen) hat typische coensche Elemente wie das Absurde, eine amoralische Gesellschaft, die scheinbar gegen den Protagonisten arbeitet und der Zufall, der manchmal für, manchmal gegen ihn zu sein scheint. Und natürlich ein Protagonist, der doch eigentlich nichts wirkich böses verbrechen wollte und dessen Handlungen zum Schluss im Desaster münden. Wer mit dieser coenschen Note manchmal mehr, manchmal weniger anfangen kann, geht vielleicht trotzdem mit einem „Mäh“ aus dem Kino. Oder Wohnzimmer. Oder wo auch immer man Filme schaut. Hauptgrund dafür ist die Langatmigkeit des Films und die Vehemenz mit der Crane sich nicht aus Zwangslagen zu befreien weiß und eine gewisse Naivität an den Tag legt, die gar nicht zu seinen Äußerungen als Stimme aus dem Off passt. Da klingt es eher so, als ob er begreift, was um ihn herum passiert, was seine Handlungen nicht widerspiegeln. Wichtig ist wohl den Film als Ironie oder Satire zu begreifen. Langatmig ist er dann aber immer noch trotz des genialen Spiels von Billy Bob Thornton, Frances McDormand und Tony Shalhoub in einer wunderbar aalglatten Rolle als Star-Anwalt.
The Man Who Wasn’t There, USA, 2001, Joel Coen, 116 min, (7/10)

Ladykillers
Man sieht Ladykillers bestenfalls gegen Ende an, dass er ein Ethan und Joel Coen-Film ist. Im Remake des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1955 spielt Tom Hanks den Professor G.H. Dorr, der nicht viel Gutes im Sinn hat als er sich bei Mrs Munson (Irma P. Hall) wegen des zur Untermiete freien Zimmers meldet. Er tischt ihr die Story auf, dass er in ihrem Keller gerne mit den Kollegen seiner Musikgruppe proben würde, woraufhin sich die Männer in den Keller der bibeltreuen Frau verziehen und heimlich einen Tunnel bauen, der in das nahegelegene Casino führt, um es leerzuräumen. Dabei ist Vorsicht angebracht, damit sie nicht auffliegen. Andererseits geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Der Name des Titels ergibt sich daraus, dass wenn Mrs Munson rauskriegt, was in ihrem Keller wirklich vor sich geht, die Männer um Prof. Dorr sie wahrscheinlich umbringen müssen. Und da sie sich nicht wirklich schlau anstellen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es soweit kommen muss. Die Idee des Films ist nun erstens nicht neu, denn es ist ein Remake und zweitens sind die Figuren derartig grobschlächtig überzeichnet, dass es weh tut. Da wäre beispielsweise die Figur von Marlon Wayans, einem jungen schwarzen Mann, der HipHop hört, viel Flucht und mit einer Waffe rumläuft oder Tzi Ma als „Der General“, ein asiatischer Mann mit Kampfkunstkenntnissen und oder militärischem Hintergrund. Ist das Zufall oder wirken insbesondere die Charaktere mit ausländischen Wurzeln so stereotyp, dass es weh tut? Es tut jedenfalls weh. Humor hat der Film, aber es fällt aufgrund der plumpen Charakterzeichnung an mindestens der Hälfte der Szenen schwer zu lachen. Obwohl der Film coole Kniffe hat wie das Bild von Munsons Ehemann, das je nach Situation einen anderen Gesichtsausdruck hat. Planen die Männer etwas Böses, scheint sein Antlitz vom Kaminsims böse auf sie herunterzuschauen. Machen sie Dummheiten, lächelt er. Grotesker und schwarzer Humor ist eigentlich das Markenzeichen der Coen-Brüder, aber hier ist es deutlich schief gegangen und wirkt mehr wie üblicher, leichter, Traumfabrik-Comedy-Mist. Man merkt dem Film an, dass zu der Zeit der Geist der Coen Brothers durch die Geldmaschinerie in Hollywood gebrochen war.
Ladykillers, USA, 2004, Ethan und Joel Coen, 104 min, (4/10)

„A serious Man – Trailer (deutsch/german)“, via Universum Film (Youtube)
A Serious Man
Der Physikprofessor Larry Gopnick (Michael Stuhlbarg) hat es schon nicht einfach. Da nistet sich sein Bruder bei ihm ein und macht keine Anstalten sich eine eigene Wohnung zu suchen, dann möchte sich seine Frau (Sari Lennick) von ihm scheiden lassen, bei seinem Arbeitgeber gehen Beschwerdebriefe gegen ihn ein – gerade als es darum geht, ob er auf Lebenszeit eingestellt werden kann und als ob das nicht schon reicht, versucht ihn einer seiner Studenten zu bestechen und egal wie er reagiert, gerät er in eine moralische Zwickmühle. Und muss plötzlich öfter mit seinem Anwalt sprechen als er sich wünscht. Und das ist erst der Anfang. A Serious Man ist es, was die meisten Charaktere in dem Film versuchen zu sein, zumindest die Erwachsenen. Während anderen das scheinbar leicht gelingt, fliegt Larry aber ein Bullshit nach dem anderen ins Gesicht. Als sein Leben ihm mehr und mehr zu entgleiten droht, sucht er Rat bei den Rabbis seiner jüdischen Gemeinde – ein Fest an kuriosen Begegnungen. Larry scheitert daran auch mal nein zu sagen – er versucht es immer allen recht zu machen. Durch seine verzweifelte Ernsthaftigkeit ist er einerseits eine komische, aber auch eine tragische Figur. Das restliche tun die Nebencharaktere in dieser schwarzen Komödie und die grotesken Situationen. Wie beispielsweise die stoischen Nachbarn, die Larrys Rasen ungefragt mähen. Oder die laszive, wortkarge Nachbarin. Die Situationskomik macht, dass man sich fast schlecht fühlt, wenn man über all das lacht, was Larry passiert. Die Lehre von der Geschichte und das abrupte Ende des Films, lassen den Zuschauer aber dann doch schwer schlucken. Kein Wunder, dass die Coen Brüder dafür Oscars abgesahnt haben. Und unterschwellig wird neben all dem auch noch der Lebensgeist jiddischer Gemeinden in den 60er vermittelt – vermutlich so wie die Coen Brüder selber aufgewachsen sind. Je nach Zuschauer kann das aber einen Tick zu hermetisch wirken. Und das Ende des Films ist wieder sehr speziell und hat zumindest die Autorin dieser Review anfangs sehr vor den Kopf gestoßen und zu einer wesentlich niedrigeren Bewertung veranlasst. Manchmal ist es gut noch ein bisschen über das Gesehene nachzudenken.
A Serious Man, USA, 2009, Ethan und Joel Coen, 105 min, (8/10)

Inside Llewyn Davis
Ich bin ein bisschen überrascht, wenn ich über Folkmusik lese. Wikipedia listet wunderbar die Geschichte der Folkmusik seit den frühesten Anfängen u.a. in der Volksmusik Europas und Nordamerikas auf. Aber zur Jetzt-Zeit sagt Wikipedia, dass Folkmusik eher eine Randerscheinung ist. Ach echt? Ich höre es und meine zu wissen, dass mit Bands wie Mumford & Sons in den 2000er Jahren wieder einen Run auf Folkmusik auslösten und den Weg für neue Subgattungen frei machten. Inside Llewyn Davis kennzeichnet aber die Folkmusik-Szene der 50er und 60er Jahre, die ihre Stars hatte, zu denen aber nicht der titelgebende Llewyn Davis (Oscar Isaac) gehört. Der Film ist eine Aneinanderreihung des Scheiterns und der Zuschauer steigt an dem Punkt ein, an dem der Drops für Davis scheinbar schon gelutscht ist. Von einer Karriere als Folkmusiker kann er schon nicht mehr sprechen. Er hat so wenig Kohle, dass er sich keine Wohnung leisten kann und nur bei Bekannten und Freunden unterkommt, mit denen er es sich letzten Endes auch verscherzt. Ob Davis schon immer ein Arschloch war, wissen wir nicht, wir ahnen nur, dass es wohl nicht immer so war. Wie war Davis wohl bevor sich sein Freund und Bandkollege das Leben nahm? Auch wenn er Jean (Carey Mulligan), die Freundin seines Kumpels Jim (Justin Timberlake), geschwängert hat und ihr deutlich sagt, dass sie abtreiben soll, fragen wir uns, was Davis zu dem machte, was er ist? Oder wenn er einen halbherzigen Versuch startet die durch seine Schuld ausgerissene Katze seiner Gastgeber wiederzubringen und nicht mal merkt, dass er die falsche Katze zurückgebracht hat. Wer sich fragt, was nun die Handlung des Films ist: es ist die Suche von Davis nach einem Platz. Ich will nicht zuviel verraten, aber es ist eine von den Coen Brüdern künstlerisch in einer Schleife angeordnetes Road-Movie. Mit Katze. Inside Llewyn Davis ist eine Ode an den Künstler, an das Scheitern mit Überzeugung, das sich Durchschlagen und an die Folk-Szene der 50er/60er Jahre mit einigen Easter-Eggs für Kenner und Fans 😉 und vor Allem: Musik, die nichts geringeres anspricht als die Seele.
Inside Llewyn Davis, USA/Frankreich, 2013, Ethan und Joel Coen, 105 min, (9/10)

Ich weiß nicht, was es ist, aber die Coen Brüder adressieren Themen und kreieren Stoffe, die mir beim ersten Mal gar nicht unbedingt schmeckten. Als Teenager fand ich keinen Zugang zu ihren Stoffen und der Kultstatus so mancher Filme wollte sich mir nicht erschließen. „The Big Lebowski“ musste ich beispielsweise zwei Mal sehen, um den Film und dessen Witz und Ironie so richtig schätzen zu können. Vorher habe ich mich eher gefragt, was das für komische Typen sind, die sich da so gehen lassen und warum die Deutschen wieder so komisch im Film dargestellt werden. Heute sehe ich das anders und kann bei weitem mehr über den Film lachen, v.A. wenn der Dude wieder über der Stadt fliegt. 😉 Ähnlich war es bei „A Serious Man“, den ich kurz nach dem ersten Mal schauen, gar nicht so toll fand. Ich fand ihn unfair. Zu düster und negativ. Aufgrund seines Endes. Danach fand ich ihn genial. Das spricht aber für die Coens, denn es zeigt, dass sie anspruchsvolles Kino machen, an denen der Zuschauer reifen kann oder sogar muss und zum nachdenken und hinterfragen erzogen wird. Und mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors, das auf die Schippe nimmt, was wir so für normal empfinden. Der Wendepunkt war übrigens als ich 2013 im Kino „Inside Llewyn Davis“ sah – es war der Film, der mir beibrachte, dass da Genies am Werk sind. Wie empfindet ihr die Filme der Coen-Brüder? Liebt ihr ihre Filme oder brauchtet ihr auch erst eine Aufwärmphase? Welche Filme der Coen Brüder könnt ihr wärmstens empfehlen? Welche haben euch vielleicht eher enttäuscht?
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
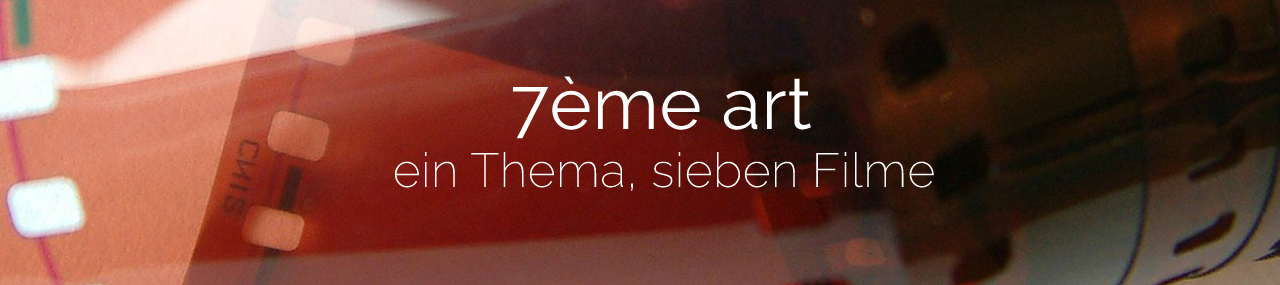
Schreibe einen Kommentar