Letztes Jahr feierte ich zehn Jahre oscarnominierte Filme besprechen. Dabei sage ich nicht, dass ihr die Veranstaltung mögen müsst oder dass ich sie (immer) mag. Aber es macht mir Spaß mir Filme rauszupicken, die nominiert sind und sie zu schauen. Denn so viel muss man der dekadenten Veranstaltung zugestehen: sie ehrt Filme, die diskutierenswert sind. Daher gibt es auch heute wieder sieben Filme, die in diesem Jahr für (mindestens) einen Oscar nominiert sind.
Das Lehrerzimmer
Carla Nowak (Leonie Benesch) unterrichtet Mathematik und Sport an einem Gymnasium. Außerdem ist sie dort Klassenlehrerin. An der Schule wird allerdings geklaut und infolge einer ersten Verdächtigung werden alle Jungs aus Carlas Klasse gefilzt, obwohl sich letzten Endes der Verdacht nicht bestätigt. Eigentlich um die Kinder zu entlasten und Unruhe zu beenden, geht Carla der Tätersuche auf andere Weise nach. Daraus entsteht eine Kettenreaktion, die bald nicht nur Carla an den Rand des Zusammenbruchs bringt.
Kommunikation hätte hier alles oder nichts ändern können. Vor Allem aber hätte ein achtsames und gleichberechtigtes Miteinander geholfen. Dass der Zweck die Mittel nicht heiligt beweist İlker Çataks Film nach einem Drehbuch von ihm und Johannes Duncker meisterlich. Die Schulleitung und das Kollegium ist sich aktueller Debatten (genderneutrale Sprache, Diversität & Inklusion, Bias, unvm.) durchaus bewusst und versucht im Alltag danach zu handeln. Wenn es aber um die Null-Toleranz-Politik geht, dann ist es schon mal okay die Kinder zu erpressen, damit sie Verdächtige nennen. Die idealistische, junge Lehrerin Carla will das nicht mit ansehen und läuft in eine schwierige Situation, begeht einen kleinen Fehler, der sich enorm hochschraubt. Das Lehrerzimmer ist ein packender Film, der ein ausgesprochen gutes Timing hat und auch nicht davor zurückschreckt seine Hauptfigur zu kritisieren, d.h. auf Grauschattierungen zu setzen. Und das in allen Punkten – man denke nur an die Täter:innen-Frage. Meines Erachtens nach muss ein Film, der zeigt wie schwierig das erörtern von Schuld ist für seinen dargelegten Fall keine Lösung präsentieren. Vor Allem, wenn die Botschaft ist: manchmal gibt es keine zufriedenstellende Lösung. Dennoch wird es sicherlich Zuschauende fordern bzw. ihnen missfallen. Top Film für alle, denen der japanische Confessions ein tick too much war.
Das Lehrerzimmer, Deutschland, 2023, İlker Çatak, 98 min, (8/10)

Die Schneegesellschaft
Bei Die Schneegesellschaft handelt es sich nicht einmal um die erste Verfilmung der wahren Begebenheiten um den Absturz des Fluges 571. J. A. Bayonas Verfilmung basiert auf dem (im Original) gleichnamigen Roman von Pablo Vierci, dessen Schulfreund an Bord der Maschine war. Flug 571 stürzte 1972 über den Anden ab. An Bord waren hauptsächlich Mitglieder einer uruguayischen Rugbymannschaft, deren Kampf um das Überleben in beeindruckenden Bildern erzählt wird. Er ist einer der wenigen Katastrophen- bzw. Überlebensfilme, die die psychologischen Auswirkungen zeigen, wenn man bemerkt, dass nach einem gesucht wird – und die Suche eingestellt wird.
Ähnlich anderen Filmen, die Überlebenskampf inszenieren reiht sich hier zuverlässig eine Katastrophe an die andere, was das Schicksal der Menschen an Bord trotz vorhersehbarer Elemente natürlich nicht weniger erzählenswert macht. Dennoch erklärt der Film Logiklücken nicht, beispielsweise warum ihnen ihre Feuerzeuge in der Eishölle nichts bringen und lässt Zuschauende teilweise fragend zurück mit fragmentarischen Erklärungen. Wird Schneeblindheit mal erwähnt? Nein. Es ist mir fern respektlos zu sein – ich bewerte den Film und wundere mich über dessen Entscheidungen. Die unglaubliche Leidensgeschichte der Opfer und deren Familien sind absolut außerhalb der Wertung. Der Film jedoch lässt Lücken abseits der Schauwerte und emotionalen Spitzen.
Die Schneegesellschaft (OT: La sociedad de la nieve), Spanien, 2023, J. A. Bayona, 143 min, (5/10)

Ich sehe was, was du nicht siehst
Wes Anderson verfilmte mit „Henry Sugar“ (ich erlaube mir den Originaltitel abzukürzen) eine Kurzgeschichte Roald Dahls, der hier auch als Erzähler fungiert und von Ralph Fiennes verkörpert wird. Sie handelt von dem Dandy Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), dessen Leben durch eine Kurzgeschichte aus den Angeln gehoben wird. Er erfährt darin wie man ohne die Augen zu benutzen sehen kann. Wie wir es von Wes Anderson gewöhnt sind, ist der Kurzfilm kreativ umgesetzt als Binnenerzählung, d.h. Erzählung in einer Erzählung in eine Erzählung verschachtelt. Die Darstellenden (u.a. auch Dev Patel, Ben Kingsley) nehmen darin jeweils auch mehrere Rollen ein und laden zu verschiedenen Interpretationen ein – auch der, dass wir es mit unzuverlässigen Erzählern zutun haben. Die vierte Wand spielt hier eine besondere Rolle und es stellt sich konsequent die Frage: zu wem wird gerade gesprochen? Teilweise als Plansequenz inszeniert bzw. als extra lange Shots vor sich bühnenartig abwechselnden Kulissen erzeugt es einerseits Künstlichkeit, ist andererseits ein wunderbarer Bruch mit Erwartungen. Und doch sitzt man am Ende etwas perplex vor der Mattscheibe und fragt sich: hat Wes Anderson neben all den Spielereien vergessen uns zu zeigen, was die Botschaft ist?
Ich sehe was, was du nicht siehst (OT: The Wonderful Story of Henry Sugar), UK/USA, 2023, Wes Anderson, 39 min, (7/10)

Killers of the Flower Moon
Mit einer größenwahnsinnigen und nicht gerechtfertigten Laufzeit von dreieinhalb Stunden verfilmt Martin Scorsese die wahren Begebenheiten über Morde an den Osage-Ureinwohner:innen nach den Enthüllungen in David Granns Sachbuch. Es handelt davon wie die Osage Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert zu Reichtum gelangten, nachdem in ihrem Gebiet Erdölvorkommen entdeckt und monetarisiert wurden. Der Film folgt Mollie (Lily Gladstone), einer Osage, die Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) kennenlernt und sich verliebt. Ernest ist aber auch der Neffe von William „King“ Hale (Robert De Niro), der ein dichtes Netz an Mord, Betrug und Infiltration spinnt, um sich den Reichtum der Osage unter die Nägel zu reißen. Er hofft auf eine Heirat zwischen Ernest und Mollie.
Es ist schon erstaunlich wie sehr ein Film dieser Spieldauer wegen ungesagter und nicht dargestellter Dinge kränkelt, diese ihn aber auch interessant machen können. De Niros Darstellung des King Hale (den es wirklich gab), lässt erst nach und nach fein granular erkennen, dass er Pläne mit den indigenen Familien hat. Lange Zeit kann man als Zuschauende auch nur darüber munkeln, ob beispielsweise Ernest das volle Ausmaß seiner Handlungen und der Vorgänge klar ist. So richtig viel ist das nicht, um eine Handlung aufzubauen. Spannend ist sie aber trotzdem. Scorsese findet zudem in seiner Manier Bilder, die lange nachhallen wie gerade zu Beginn des Films, wo es nicht Stunden dauert, um die Perfidität und Schaurigkeit der Morde zu versinnbildlichen. Scorseses Portrait über das lange Ignorieren der Mordserie und Ausbeutung hätte sich aber letzten Endes deutlich mehr den Osage und ihrer Geschichte widmen können, statt den Tätern, die wir in immergleichen, langatmigen Ränkeschmied-Situationen erleben. Wozu?
Killers of the Flower Moon, USA, 2023, Martin Scorsese, 206 min, (7/10)

Maestro
Dieser Bradley Cooper hat verstanden, was ein klassischen Oscarstoff (Bait?) ist. Er inszenierte den Film, schrieb das Drehbuch zusammen mit Josh Singer und schlüpfte selbst in die Rolle des titelgebenden Maestro, des legendären Komponisten Leonard Bernstein. Zentrum der Handlung ist einerseits Talent als auch die Beziehung Bernsteins und seiner Frau Felicia Montealegre, gespielt von Carey Mulligan.
Der Film geht dabei auf Bernsteins Affären mit Männern ein, nennt aber bedauerlicherweise (oder rücksichtsvollerweise?) keine Labels. Viel mehr zentriert er die enge Verbundenheit zwischen Leonard und Felicia auf tatsächlich sehr rührende Weise. Als zwei, die trotz ihrer Differenzen letzten Endes vor Allem immer zwei Dinge verstanden: einander und das Talent des jeweils anderen. Der Film hat seine emotionalen Spitzen, vor Allem ist es eine Ode an Bernsteins Musik und Felicias Scharfsinn. Aber er hat auch seine Debatten, seine Strecken, erzählerische Leerstellen und kreative Entscheidungen, die dem Film überraschend wenig nützen. Beispielsweise dass er während des Schwarzweißfilm-Zeitalters in Schwarzweiß präsentiert wird, danach als Farbfilm. Ob es auch klug war, dem eigenen Ende vorzugreifen? Oder sich Maestro zu nennen, obwohl es kein Biopic sein will? Hm. Jedenfalls bekommt er einen Extrapunkt dafür wie Bradley Cooper Bernsteins Mimik und v.A. Gestik verinnerlicht hat. Neben Debatten, die ich wieder nicht mit in die Bewertung einbeziehen kann, weil mir das nicht zusteht.
Maestro, USA, 2023, Bradley Cooper, 129 min, (7/10)

Past Lives – In einem anderen Leben
Mit einem Abstand von jeweils zwölf Jahren erzählt Past Lives wie sich Nora (Greta Lee) und Hae-sung (Teo Yoo) als Kinder trennen mussten, nach Noras Auswanderung online wiederfanden und sich in der Gegenwart in den USA wiedertreffen. Schon einmal hat es nicht sollen sein, nun wirbelt Hae-sungs Besuch bei Nora einiges an Gefühlen auf. Erinnerungen an Beziehungen, an Kindheitsträume, an die erste Liebe, an das Verlassen des Bekannten. Und er stellt Noras Ehemann Arthur (John Magaro) vor eine fast unmögliche Aufgabe.
Die sollten wir uns alle merken. Obwohl Hauptdarstellerin Greta Lee eh schon zahlreiche Engagements hatte wie auch Teo Yoo, der übrigens neben drei weiteren Sprachen fließend Deutsch spricht. Allen voran auch Regisseurin Celine Song, die sich traut eine Liebesgeschichte in drei Akten zu erzählen und gängigen Vorstellungen von Geschwindigkeit und Spannungsaufbau trotzt. Mit den drei durch je zwölf Jahre getrennten Sequenzen mag Past Lives ein anderes Gefühl von Geschwindigkeit als andere Filme vermitteln, erzählt aber eine einfühlsame und wunderschöne Geschichte von Identität angesichts von Sprache, Heimat, Kultur, Beziehung, Beruf und all den anderen Attributen die das Spektrum von „Selbst“ ausmachen. Past Lives beantwortet sehr leicht die Frage, ob wir in der Tat verschiedene Menschen auf verschiedene Weise lieben können. Ich hätte es dem Film jedoch nicht übel genommen den Ehemann nicht ganz so am Rand sitzen zu lassen. Bildlich wie metaphorisch.
Past Lives – In einem anderen Leben (OT: Past Lives), USA, 2023, Celine Song, 106 min, (8/10)

Spider-Man: Across the Spider-Verse
Nach den Geschehnissen von Into the Spider-Verse findet sich „Spider-Gwen“ in einer rauen Gegenwart wieder. Ihr bester Freund kommt zu Tode und sie kann es nicht verhindern. Stattdessen wird sie von ihrem Vater, Captain Stacy, als Täterin angenommen und verfolgt. War nicht noch alles besser als sie zwischen den Welten wechseln konnten und wenigstens mit ihren Spider-Sorgen nicht alleine waren? Als es da jemanden (oder viele) gab, die verstanden wie es sich anfühlte, wenn aus großer Macht große Verantwortung folgt? Miles Morales fühlt das auch. Und da kommt mit „The Spot“ plötzlich ein „Villain of the Week“ daher, der eine plötzlich sehr persönliche Fehde entwickelt. Und es öffnet sich ein Portal zu enorm viel mehr Spidermans, die helfen wollen oder Hilfe brauchen. Der Unterschied ist nicht immer ganz klar.
Wie auch schon der Vorgänger gibt der Animationsfilm alles. Jedes Multiversum setzt auf einen eigenen Artstyle und packt wieder die Kunst in die 3D-Animation. Da sind handgezeichnete Passagen, Live-Action-Inserts, Mixed Media, fantastisches Spiel mit Perspektive und Licht. Daneben gibt es viele Easter Eggs (Cameos!), zeitgeistige versteckte Botschaften (protect trans kids!) und noch so vieles mehr. Aber es ist bei Weitem nicht alles so effektiv wie es sein könnte. Der Unschärfe-Effekt am Rand des Blickfelds (beispielsweise Szene mit der Dach-Party) verwirrt mehr und lässt viel zu wenig vom Frame fokussiert. Die partiell verwendeten Texturen mit geometrischen Formen haben wenig Funktion. Das mag meckern auf hohem Niveau sein, aber auch inhaltlich ist es ungar wie der Film trotz des hohen Erzähltempos letzten Endes über eine Stunde Exposition hat und als klassischer „zweiter Teil“ nur weniges seiner Handlung abschließt, aber viel den dritten Teil vorbereitet. Und dann wieder die Frage: soll ich es gut finden, wenn ein Film großartig aussieht, aber unter gar nicht so großartigen Umständen entstand? Spider-Man: Across the Spider-Verse macht Spaß und ist eine wahnsinnige Explosion an Querverweisen. Täuscht aber durch Tempo und Easter Eggs über Schwächen hinweg. Die Persiflage auf Anime aus dem ersten Teil wird nur kurz wiederholt, nervt aber immer noch.
Spider-Man: Across the Spider-Verse, USA, 2023, Joaquim Dos Santos/Kemp Powers/Justin K. Thompson, 141 min, (7/10)

Ihr vermisst in der Liste eine ganze Menge andere Filme, die für die 2024er Academy Awards nominiert sind? Ich auch. Aber die gibt es im Blog wahrscheinlich schon an anderer Stelle. Beispielsweise die Besprechung zu Barbie, Oppenheimer, Anatomie eines Falls und Poor Things. In welchen Film setzt ihr große Hoffnung was die Oscars betrifft? Wenn ihr rauslest, dass „Past Lives“ und „Das Lehrerzimmer“ meine Lieblingsfilme aus dieser Liste sind, dann lest ihr das richtig. Und eure?
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
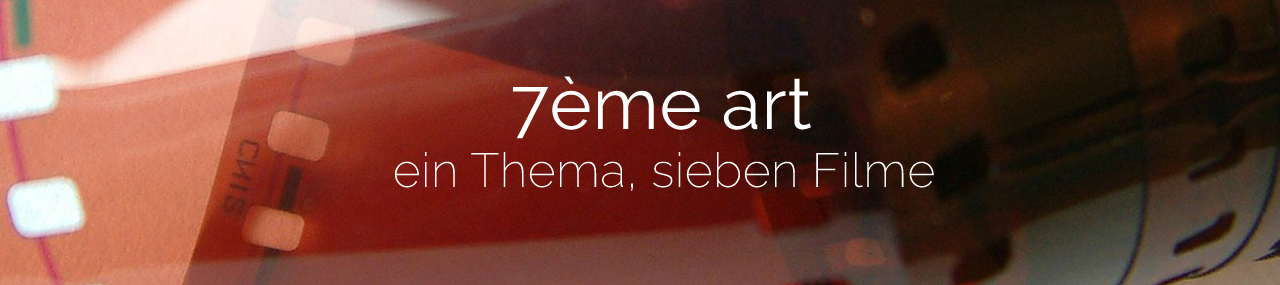
Schreibe einen Kommentar