Obwohl Das Piano kurze Zeit später einer meiner Lieblingsfilme werden sollte, war meine erste Begegnung mit Jane Campion ihre Serie Top of the Lake. Darin spricht sie schonungslos Themen wie verweigertes Selbstbestimmungsrecht, Missbrauch, Prostitution und Einwanderung an – und das mit zahlreichen weiblichen Hauptrollen und verschiedenen Rollenbildern. Dabei machte sie schmerzlich klar, dass diese Themen teilweise nur hinter einem dünnen Schleier aus angeblicher Kultiviertheit verborgen sind. Aber eben immer noch da. Ich bewunderte sie unendlich für so rigorose, fast schonungslos brutale Stoffe, die trotzdem voller zarter Momente sind. Immer wenn ich mal wieder „Das Piano“ sah oder „Top of the Lake“ meinen Weg kreuzte, schämte ich mich innerlich, dass ich nie ihre anderen Filme gesehen habe. Und das wollte ich dann doch mal ändern. Der gemeinsame Nenner der sieben besprochenen Filme ist heute, dass die wunderbare Jane Campion bei ihnen Regie führte.
Orangenschalen – Eine Übung in Disziplin
Fast vierzig Jahre nachdem Jane Campion mit ihrem nur rund neun Minuten langen Kurzfilm als erste Frau die Goldene Palme in Cannes gewann, ist der Reiz von Orangenschalen erahnbar, aber springt einem nicht ins Gesicht. Der Kurzfilm handelt von einer Familie, deren kurze Autofahrt einerseits die titelgebende Übung in Disziplin wird, aber nicht wie anfangs erwartet für den jüngsten in ihrer Reihe, sondern für sie alle. Die Klamotten und Frisuren im ganz offiziellen Erstlingswerk Campions verbreiten angenehmes Retro-Feeling. die Übung in Disziplin und die sich damit verbundene, entladende Frustration der einzelnen Charaktere ist im Grunde etwas mild. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Jane Campion liefert aber bereits hier einen Vorgeschmack auf ihre vielen folgenden Filme mit komplexen, weiblichen Charakteren an der Spitze. Hier ist es eine Erwachsene, die zugunsten der Übung in Disziplin verzichten soll und sich dazu entschließt wiederum ihre Disziplin sausen zu lassen. Die Entscheidung ist abseits von weiblichen Stereotypen wie der besonnenen Mutterfigur (sie ist ja auch nicht die Mutter, sondern die Tante 😉 ) und entlarvt, dass die Forderung von Disziplin immer Disziplin fordert (ha!); aber auch wie schwierig alleine das Beziehungsgeflecht dreier Menschen sein kann und die Auswirkungen von Handlungen. Der Film erscheint in seiner Kürze mit viel Verstand für Charaktermomente gefilmt, aber insgesamt etwas seicht für heutige Sehgewohnheiten.
Orangenschalen – Eine Übung in Disziplin (OT: An Exercise in Discipline – Peel), Australien, 1982, Jane Campion, 9 min, (5/10)

„Ein Engel an meiner Tafel (1990)“, via Filme – wahre Begebenheiten (Youtube)
Ein Engel an meiner Tafel
Ein Engel an meiner Tafel ist die Verfilmung dreier Autobiografien der neuseeländischen Autorin Janet Frame, die auch noch selber am Drehbuch mitwirkte. Der Film gliedert sich entsprechend der Bücher in drei Teile. Der erste widmet sich der Kindheit Janets, die mit vielen Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Sie hat einen auffälligen, dichten, roten Lockenschopf; ist nicht gerade dünn und läuft meist in „upcycelten“ Klamotten herum. Es ist nicht selten, dass eine Bluse mal ein Vorhang war oder sie in zerschlissenen Pullovern zur Schule geht. Die Abschätzigkeit mit der sie behandelt wird, macht sie zu einem vorsichtigen und schüchternen Kind und im zweiten Teil zu einer ebenso empfindsamen jungen Frau. Bereits als Kind entdeckte sie ihre Liebe zum Schreiben und zu Gedichten. Sie macht früh erste Gehversuche als Autorin. Ihre Familie wird von vielen Schicksalsschlägen heimgesucht. Zusammen mit dem Druck einen Job zu finden und als Sonderling betrachtet zu werden, hegt sie erste Selbstmordgedanken. Als sie einmal einen Schritt zu weit geht, wird sie in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und nicht so schnell wieder rausgelassen. Während draußen ihr erstes Buch veröffentlicht wird, erklärt man Janet, dass sie Schizophrenie hätte und die Elektroschocktherapie die einzige Behandlungsmethode wäre. Und bevor ihr fragt: nein, der Film spielt mitnichten im Mittelalter.
Janet wird Jahre in Nervenheilanstalten zubringen und keine Antwort auf die Frage bekommen wie lange sie noch bleiben muss und ob die Therapien ihr helfen. Es ist eine Fehldiagnose. Eine fast willkürlich anmutende Aktion und das Wegsperren eines Menschen, bei dem man gar nicht erst versucht zu verstehen, was sie hat oder fühlt. Letzten Endes ist es immer und immer wieder die Literatur, die sie rettet. Jane Campions Film ist ein einfühlsames Portraits Janet Frames. Ich kannte die Autorin vorher nicht, bin aber tief beeindruckt wie sie sich immer wieder durchgeschlagen hat und werde demnächst mal in Janet Frames Bücher reinlesen. Bei all dem was sie erlebt hat, erweckt der Film bei mir den Wunsch sie mal treffen zu können und ich wüsste zu gern wie es für Campion war mit ihr zusammenzuarbeiten. Der Film selber ist deutlich ein Kind seiner Zeit. Mit über zweieinhalb Stunden Laufzeit nimmt er sich viel Zeit für Frames Biografie(n), aber für heutige Sehgewohnheiten auf ungewöhnliche Elemente fokussiert. Man will brennend gern wissen, warum man Janet nicht aus der Heilanstalt entlässt, warum und von wem sie überhaupt eingewiesen wurde und warum sie nicht mehr Gegenwehr leistet. Aber es ist einer der typischen Filme der 90er Jahre, der sehr oft den Konflikt und das Kernelement zeigt, aber nicht zwingend den Weg dahin oder das direkte Ergebnis. Das ist einerseits ok, da es um das Portrait einer empfindsamen Person geht, deren Umwelt weniger als gar keine Rücksicht auf ihre Veranlagung nimmt; aber andererseits bei anderen Filmen wie Das Piano besser gelungen. So meint man sehr häufig in dem Film den Faden zu verlieren und nicht zu verstehen, wie man hierher gekommen ist.
Ein Engel an meiner Tafel (OT: An Angel at My Table), Neuseeland/Australien/UK, 1990, Jane Campion, 158 min, (6/10)

Portrait of a Lady
Henry James‘ Roman Bildnis einer Dame zu adaptieren muss eine Mammutaufgabe sein. Laura Jones hat die gewagt – ihr Drehbuch ist die Basis für Jane Campions opulente Verfilmung. Zentrale Figur des Stoffs ist Isabel Archer (Nicole Kidman). Die Amerikanerin will nicht denselben eingetretenen Weg gehen, den viele ihrer Zeitgenossinnen folgen. Sie will nicht „eine gute Partie machen“ und möglichst reich heiraten, sondern sich vom Schicksal treiben lassen. So verneint sie die Heiratsanträge des reichen Lord Warburton (Richard E. Grant), des schönen Caspar Goodwood (Viggo Mortensen) und ihres Cousins Ralph Touchett (Martin Donovan), der sie allerdings offenbar von ganzem Herzen liebt, und bereist stattdessen die Welt. Nachdem ihr Onkel verstorben ist, vererbt er ihr den Löwenanteil seines Vermögens und gibt ihr damit alle gesellschaftliche Freiheit, die man sich nur wünschen kann. Ausgerechnet jetzt, wo sie sich um ihre Zukunft und Absicherung keine Gedanken mehr machen muss, tritt Gilbert Osmond (John Malkovich) in ihr Leben, bekundet seine Liebe und sie willigt in die Heirat an und besiegelt ihr Unglück.
„The Portrait of a Lady Official Trailer #1 – John Malkovich Movie (1996) HD“, via Movieclips Classic Trailers (Youtube)
Nicht, dass Heirat grundsätzlich ein Unglück wäre 😉 , aber Osmond ist lediglich hinter Isabels Vermögen her. John Malkovich kann auch einen ausgezeichneten Dreckskerl spielen. Nicole Kidmans, Jane Campions und Henry James‘ Isabel Archer ist ein früh emanzipiertes, dennoch tragisches erzähltes Frauenschicksal. Im Grunde ist Isabel eine Vordenkerin, eine Pionierin: sie sagt nein zu Vernunftehen. Durch gute Menschen in ihrem Umfeld bekommt sie die Mittel um ihren Traum von einem Leben außerhalb gesellschaftlicher Korsetts umzusetzen, nur um dann in die Fänge eines Lebemanns zu geraten, der sie mit schönen, romantischen Worten und Gesten verführt. Letzten Endes landet Isabel genau da, wo sie nicht hin wollte. Die Kernbotschaft ist schnell verstanden. Jane Campions Film ist opulent und hat inszenatorische Rafinesse. Sie beginnt beispielsweise mit einem Intro voller Frauen der Gegenwart, die von dem Erlebnis eines (ersten) Kusses berichten und damit einen (angenehm) krassen Gegensatz zu dem Verständnis von Beziehung und Bindung gegen Ende des 19. Jahrhunderts formen.
Aber der Film bleibt trotzdem über weite Strecken schwer zugänglich, was v.A. daran liegt, dass Isabel als treibende Kraft ab der Hälfte ihre wahren Gefühle nicht mehr ausspricht und man nahezu alles interpretieren muss. Warum bleibt sie an Osmonds Seite? Weil sie sonst mittellos oder vor der Öffentlichkeit eine Geächtete wäre? Weil sie immer noch denkt, dass ihre Beziehung mal gut anfing? Weil sie Osmonds Tochter Pansy (Valentina Cervi) nicht im Stich lassen will? Oder hat sie den Betrug nicht durchdrungen? So besteht die zweite Hälfte aus fiesen Gängeleien und sehr langatmigen Versuchen Pansy dazu zu bewegen sich für eine Liebesheirat zu entscheiden, damit sie nicht auch Osmonds Pläne umsetzt. Gegen Ende ist der Film dann zu hermetisch, verkopft, langatmig und dramatisch. Nichtsdestotrotz hat Portrait of a Lady ein großartiges, aber schmerzhaftes Motiv; viele denkwürdige Szenen und eine Protagonistin, die aufgrund ihrer vielen Facetten ein schöner Gegenbeweis zum „strong female lead“ ist. Wir brauchen keine eindimensionalen pseudo-starken Frauencharaktere, sondern solche, die gleichzeitig aufgeklärt und zart sein können.
Portrait of a Lady (OT: The Portrait of a Lady), USA/UK, 1996, Jane Campion, 144 min, (6/10)

Holy Smoke
Es ist ein Moment der Erleuchtung. Als der Guru Ruth Barron (Kate Winslet) in die Augen blickt, die Masse der Umsitzenden ekstatisch hin und her wiegt und er ihr an die Stirn tippt, wird in Ruth ein Schalter umgelegt. Die junge Australierin beschließt in Indien zu bleiben und sich seinem Kult anzuschließen. Als ihre Eltern das mitbekommen, engagieren sie den Sektenexperten und Ausstiegsberater P.J. Waters (Harvey Keitel). Er soll Ruth bekehren, die unter einem Vorwand aus Indien zurück nach Australien geholt wird. Sie isolieren Ruth und Waters im Outback. Was folgt ist vor Allem ein Psychokrieg, der nicht ganz so abläuft wie Waters plante.
Waters Plan beinhaltet die Konfrontation, Provokation und geplante Bekehrung bzw Erkenntnis Ruths. Allerdings scheitert er an Ruths starker Persönlichkeit. Sie ist keineswegs ein naiver und schwacher Geist, sondern hat eine komplexe Persönlichkeit und Lust am Leben. Sie beginnt sehr bald Anziehung auf Waters auszuüben, der seine eigene Professionalität über den Haufen wirft. Holy Smoke ist in seiner grundlegenden Story ein echter Kunstgriff. Niemand ist hier das, was er vorgibt oder andere meinen was er wäre. Ruth ist tougher als man erwartet, Waters das komplette Gegenteil. Er inszeniert sich in seiner Auftrittsszene als coolen Typen. Als Mann von Welt. Als der, der den Plan hat. Gegen Ende des Films ist Ruth sein Kult und er ihr Anhänger. Kate Winslets Ruth durchläuft quasi alle Phasen der Selbsterkenntnis und darf alle Facetten des Emotionsspektrums zeigen. Jane Campion beweist wieder viel Fingerspitzengefühl für komplexe Charaktere und weibliche Leads. Das Drehbuch stammt sowohl von ihr als auch Anna Campion. Es ist allerdings auch nicht immer schön anzuschauen, wenn sich Ruth und Waters beleidigen, miteinander schlafen und wieder erniedrigen. Aber es ist verblüffend zu sehen wie diese Ruth den Experten komplett aushebelt. Leider passiert das mit etwas zuviel Chaos. Mit zuvielen Symbolen, die man nicht deuten kann. Etwas zu sprunghaft, sodass man sich als Zuschauer abgehängt fühlt. Die grotesken Figuren sorgen für comic relief. Allen voran Yvonne (Sophie Lee), die ungemein abhängig von Männern ist und fast schmerzhaft bemüht ihnen gefallen zu wollen. Holy Smoke ist nicht immer schön anzuschauen, aber ein verblüffendes Charakter-Kammerspiel.
Holy Smoke (OT: Holy Smoke!), USA/Australien, 1999, Jane Campion, 110 min, (6/10)

„Holy Smoke – Official Trailer (HQ)“, via KateWinsletWEB (Youtube)
In the Cut
Es ist schon interessant nach über zehn Jahren die Besprechungen zu einem Film zu lesen, in der ein Filmkritiker einerseits darüber beschwert, dass In the Cut Frauen als Opferlämmer degradiert und Feminismus mit Füßen tritt, sich andererseits aber über Meg Ryans Gesichts-OPs lustig macht oder den Fakt, dass sie ungeschminkt in dem Film auftritt. Gehts noch? Tatsächlich ist In the Cut aber ein trotz seiner Körperflüssigkeiten, Nacktheit und Schmutzes äußerst fader und verwirrender Film. Er handelt von der an Lyrik und Sprache interessierten Dozentin Frannie Avery (Meg Ryan), die nicht auf den Mund gefallen ist, sich aber auf eine riskante Liaison einlässt. Sie beobachtet eines Tages wie eine Frau und ein Mann in einer Kneipe rummachen. Frannie sieht das Gesicht des Mannes nicht, aber beide sind sich der Anwesenheit des anderen bewusst – und finden es geil. Als kurze Zeit später die andere Frau tot aufgefunden wird, fühlt sich Frannie nicht mehr sicher. Der Polizei-Detective Giovanni Malloy (Mark Ruffalo) befragt sie, übt eine große Anziehung auf sie aus, allerdings passt die Beschreibung des Mannes im Halbschatten auf ihn.
Von da an wabert Frannie ständig zwischen Verlangen und Gefahr. Es ist sicherlich nicht unwahr, dass ein Individuum sich Romantik wie auch Ausleben sexueller Fantasien wünscht und dass Gefahr eine gewisse erotische Anziehung begleiten kann, wenn die Zutaten stimmen. Aber es tut etwas weh, dass Franny einerseits als überlegener, vergeistigter Charakter dargestellt wird und dann ihrem impulsiven Verhalten und Tanz am Rande des Abgrunds zuzuschauen. Zumal sie von derart vielen (jetzt benutze ich den Begriff ausnahmsweise auch mal) toxischen männlichen Charakteren begleitet wird. Der Film ist in seiner Irrationalität und dem Feiern von ungesunden Umgebungen und Beziehungen einfach keine Verneigung vor Männern oder Frauen. Filmisch hat er ein paar schöne Merkmale in den oftmals am Rande geblurrten Szenen, die „echter“ menschlicher Wahrnehmung ähneln. Aber ansonsten ist er einfach wirr und schwer anzuschauen. Auf Merkmale der Literaturvorlage wie Frannies Obzession mit Slang geht er nach den ersten 15 Minuten nicht mehr ein – und verliert vielleicht deswegen das „große Ganze“ und den Sinn.
In the Cut, UK/USA/Australien, 2003, Jane Campion, 114 min, (3/10)

The Water Diary
Waren die in diesem Kurzfilm aus dem Jahr 2006 gezeigten Bilder starker Wasserknappheit damals eine Dystopie? Ich muss mich ehrlich anstrengen bei der Frage. Denn nun, 14 Jahre später, sind unsere Sommer in Mitteleuropa gerne mal vierzig Grad heiß, das Gras flächendeckend vertrocknet und die Wälder durch Brände bedroht. In Jane Campions Kurzfilm The Water Diary wird eine Gemeinde durch die Trockenheit aufgerüttelt. Besonders schwer trifft es die Kinder und Jugendlichen, die sich fragen wie ihre Zukunft aussieht und warum ihre Eltern nicht früher mehr für die Umwelt getan haben. Die Kinder einer Farm haben schwer dran zu knabbern, dass sich ihre Familie nicht mehr das Futter für die letzten beiden Pferde leisten kann. Wie immer schafft es Jane Campion ein (globales) Problem und Phänomen in surreale, aberwitzige und dramatische Bilder zu packen. Aberwitzig und schrullig, wenn die Familie ihre Kinder ein Reitturnier ohne Pferde abhalten lässt; dramatisch, wenn die unsichere Zukunft Opfer fordert. Sogar Träume haben sie von Regen, von Flüssen, gehen nachts desillusioniert nach draußen und beobachten jede noch so kleine Wolkenformation. Letzten Endes versuchen die Kinder das selber in die Hand zu nehmen. Der Kurzfilm ist unglaublich prägnant und auf den Punkt. Manchmal hätte er etwas dramatischer sein können und sich gegen Ende mehr Zeit nehmen können – aber dann wäre er wohl kein Film von Jane Campion mehr.
The Water Diary ist eins der Segmente der Kurzfilmanthologie 8, die acht sogenannte Millennium Development Goals in Filme gießt und u.a. auf Filmfestspielen zu bewundern war. Jane Campions Beitrag adressiert ökologische Nachhaltigkeit und trifft einen Nerv, wenn wir bedenken, dass bereits unser April deutlich zu trocken war und wir mit Sorge auf den Sommer blicken und uns fragen, ob der der wieder so extrem heiß wird und wie das weitergehen soll. Andere solcher Millennium Ziele waren die Gleichstellung der Geschlechter, primäre Schulbildung für alle und Bekämpfung von Krankheiten wie HIV und AIDS. Andere Segmente stammen von Gaspar Noé, Wim Wenders und Mira Nair.
The Water Diary, Frankreich, 2006, Jane Campion, 17 min, (8/10)

„The Water diary – Jane Campion“, via NoTimeLeft (Youtube)
Bright Star
Jane Campions Film handelt von der Liebe zwischen John Keats (Ben Whishaw), dem berühmten britischen Dichter der Romantik, und der jungen Schneiderin Fanny Brawne (Abbie Cornish). Beide lernen sich 1818 kennen, wo Keats in Fannys Nachbarschaft bei seinem Freund und Gönner Mr. Brown (Paul Schneider) unterkommt. Fanny und Brown sind schon einige Male aneinandergeraten. Nachdem Fanny und John sich offenkundig zueinander hingezogen fühlen, versucht Brown beide voneinander fern zu halten. Er betont u.a., dass Fanny keine Ahnung von Lyrik habe und das Genie Johns nur behindern würde. Auch das, was man im Allgemeinen „die Leute“ nennt, tun ihr übrigens, indem sie betonen, dass aus der Verbindung nichts wird, weil John ein quasi mittelloser Künstler ist. Tatsächlich zeigt die Recherche, dass die platonische Beziehung der beiden als etwas skandalöses empfunden wurde. Wie grundlegend sich Befindlichkeiten im Laufe der Zeit ändern können, sieht man allerdings auch leicht daran, dass Keats damals ein von der Kritik nicht gerade geliebter Dichter war und er heute als einer der bedeutendsten der Romantik angesehen wird. Was dem Film und der zart inszenierten Liebe eine besonders dramatische Wende gibt ist der Umstand, dass Keats nicht sehr alt wurde. Kein Spoiler, aber ein Fakt, der dazu beiträgt das eigentlich Drama und den Aufhänger des Films zu erkennen. Jane Campions einfühlsamer Liebesfilm nimmt sich viel Zeit die durch viele hässliche, äußere Faktoren beeinflusste Beziehung zu erzählen. Die Bilder sind mitunter verträumt, romantisch, teilweise fantastisch. Was für Mittel Fanny und John zum Ausdruck ihrer Liebe nutzen macht der Epoche der Romantik alle Ehre und ist dabei nicht mal besonders verkitscht. Im Film selber werden einige Gedichte von John Keats rezitiert – so auch das titelgebende Bright star, would I were stedfast as thou art. Vielleicht liegt es an mir, aber trotz der ansprechenden Handlung, der Kostüme und Kulissen, der schönen Szenen, so ganz will der Funke zwischen Fanny und John nicht auf mich überspringen.
Bright Star, Australien/UK/Frankreich, 2009, Jane Campion, 119 min, (7/10)

Es tut ein bisschen weh das zu schreiben, aber: das war tatsächlich eine Werkschau, die mir recht wenig Spaß gemacht hat. Ich musste mich etwas durchquälen. Ich halte Jane Campion für genial und habe es deswegen durchgezogen, aber ich komme auch zu dem Schluss, dass obwohl „Das Piano“ einer meiner Lieblingsfilme ist und ich „Top of the Lake“ unglaublich gut finde, der Rest ihrer Filmografie nicht mein Ding ist. Es liegt keineswegs an der Art wie sie filmt. Ich halte sie für eine große Könnerin und Kennerin. Sie ist eine der wenigen, die es durchzieht komplexe weibliche Charaktere zu Protagonisten zu machen, obwohl sie in einer Industrie arbeitet, die dort über Jahrzehnte hinweg lieber Männer gesehen hat. Sowohl vor als auch hinter der Kamera. Aber ihre Filme werden auch häufig von Motiven begleitet, die keine Faszination auf mich ausüben. Kontrolle, Kulte, Abhängigkeit. Und die für meinen Geschmack häufig sehr stark ausufern und gut und gerne mal 30 bis 60 Minuten kürzer sein könnten. Dann ist es eben leider so. Was in jedem Fall bleibt ist Anerkennung für Jane Campion. Ob ich die Stoffe nun ab kann oder nichts, tut ihrer Bedeutung in der Filmbranche keinen Abbruch. Welche Filme von Jane Campion kennt ihr und mögt ihr? Hattet ihr schon mal ein ähnliches Erlebnis mit Filmschaffenden, Autor*innen, etc. die eure Lieblingsstoffe fabriziert haben, deren Gesamtwerk euch aber nicht gleichermaßen anfixt?
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
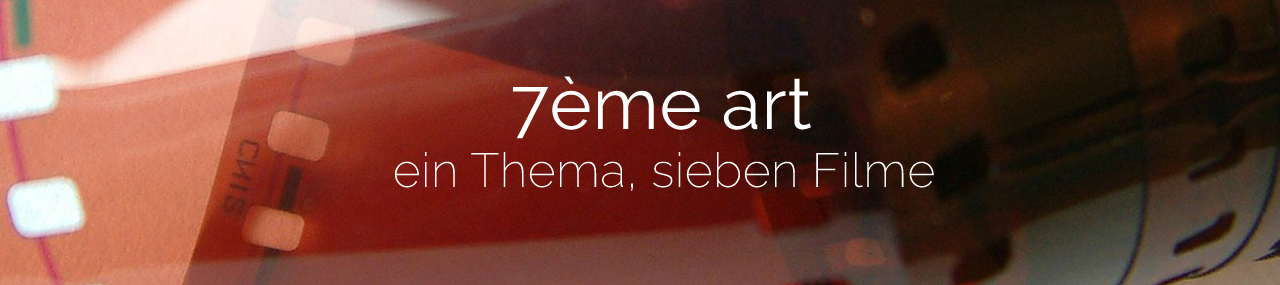
Schreibe einen Kommentar