Ach, ich habe Katherine Matilda „Tilda“ Swinton erst spät schätzen gelernt. Manchmal ist das wohl leider so. Omnipräsent war sie schon immer. Mein persönlicher Tilda-Erweckungsmoment war wohl ihr Film „I Am Love“, den ich euch sehr empfehlen, aber wegen der Regeln (kein Film doppelt) hier nicht vorstellen kann. Zusätzlich dazu lernte ich ihre volle schauspielerische Range durch die Beitragsreihe des geschätzten Kollegen mwj („Tilda Swinton Festival“) kennen. Dabei könnte ich gar nicht sagen, was ich mehr schätze. Die angenehm zurückgenommene Art mit denen sie in großen Blockbustern brilliert oder wie sie im Indie-Kino das volle Ausmaß an Exzentrik bis hin zu fein nuanciertem Schauspiel zeigen darf. Dass sie sich selber als queer bezeichnet, aber sich keinen Begriff zuordnen kann, erscheint mir auch sehr Tilda. Heute gibt es also sieben Filme mit einem gemeinsamen Nenner: Tilda Swinton.
Caprice
Im knapp halbstündigen Kurzfilm verliert sich Lucky (Tilda Swinton) in ihrem Lieblings-Modemagazin Caprice. Eben noch stand sie spät abends am Zeitungskiosk, um die erste Ausgabe zu ergattern. Im nächsten Moment taucht sie wortwörtlich in die Welt von Mode-Ikonen, Laufstegmodels und Gesellschaftskolumne ein. Nach der Euphorie folgt die Ernüchterung. Sie entlarvt die Werbung als das was sie ist: eine Masche. Die VIPs sind unpersönlich bis gar toxisch. Mehr und mehr fühlt sich Lucky als Konsumentin und Zielgruppe für das Magazin, nicht mehr als Mensch. Und schon gar nicht so als ob das Magazin etwas für sie tun will. Es ist spannend Luckys Reise zuzuschauen, die das entlarvt, was auch noch heute für Frauenmagazine (analog Männermagazine) gilt: sie vermitteln verdrehte und geschönte Bilder, fördern fragwürdige Denkmuster und verbreiten Stereotypen. Da haben wir noch gar nicht von dem Anteil an Werbung gesprochen. Tilda Swinton hat als Lucky eine sehr pragmatische und erfrischende Art auf die Avancen von Marketing zu reagieren. Joanna Hoggs Kurzfilm atmet angenehmes 80er Jahre Flair und überzeugt mit einem guten Gefühl für Szenengestaltung und weiß den Surrealismus umzusetzen. Caprice beginnt etwas langsam, wird aber immer stärker. Konsequent gut sind die Metaphern.
Caprice, UK, 1986, Joanna Hogg, 28 min, (8/10)

Tilda Swinton: Lobgesang an die Eigenart | Blow Up | ARTE, Irgendwas mit ARTE und Kultur, Youtube
Cycling the Frame
Tilda Swinton radelte in Cycling the Frame für den Sender Freies Berlin die Berliner Mauer ab. Cynthia Beatts knapp halbstündiger Kurzfilm setzt damit einen starken Kontrast zwischen Tildas Leichtigkeit und der Realität des Geteilten Deutschlands. Mal sinniert Tilda darüber, dass sie noch Sally (Potter? Regisseurin von Orlando) anrufen muss oder rezitiert ein Gedicht. Wie Tilda da durch gutbürgerliche Wohnsiedlungen fährt, Blicke auf Grenzen erhascht und Sektoren durchquert mag belanglos wirken, wenn man sich nicht die Geschichte der Mauer und ihre Implikation vor Augen führt. Ich gestehe, dass auch ich mir öfter einen kleinen Wink einer deutlicheren Botschaft erhofft hätte. Letzten Endes transportiert die sich aber in den Bildern und der Stimmung. Man lauscht Tildas Reflektionen und Gedanken während der Fahrt, bei der sie eine Freiheit und Leichtfüßigkeit an den Tag legt, die im starken Kontrast zur Mauer steht. „Der Rahmen“, der Familien trennt, Geschichte gemacht hat und nur kurze Zeit später Geschichte sein wird. Nicht umsonst haben sie das 2009 in The Invisible Frame das ich möchte sagen Experiment wiederholt.
Cycling the Frame, BRD, 1988, Cynthia Beatt, 27 min, (7/10)

Jimmy Somerville – David Motion: „Coming“, from „Orlando“, Johnny Söderberg, Youtube
Orlando
Wer könnte Orlando besser verkörpern als Tilda Swinton? In der auf einem Roman von Virginia Woolf basierenden Verfilmung spielt Tilda Swinton den jungen, androgynen Adligen Orlando. Er wächst zu Zeiten Elisabeth I. auf, verliert sein Herz, wird von der Liebe enttäuscht, dann von der Dichtung, dann von der Politik und wacht eines Morgens als Frau auf. Mit komplett anderer Umwelt konfrontiert, beginnt keinesfalls eine Sinnsuche. Lady Orlando sucht vieles im Leben, kommt aber über sich zu dem wunderbaren Schluss: „Different sex. Same person.“ Für die Umwelt ist es aber zuweilen nicht so einfach das so locker zu sehen wie Orlando.
Lest ihr heraus, dass der Film so aktuell wie nie ist, dann lest ihr ziemlich gut. Zwischen Debatte um geschlechtsneutraler Sprache und Gender Pay Gap hat der Film aus den 90ern und das Buch aus den 20er Jahren nichts an Brisanz verloren. Sally Potters Film musste eine Menge Abstriche machen, um die wendungsreiche Geschichte Orlandos in 90 Minuten Film zu pressen. Zwar will ich mich nicht dem leidigen „Das Buch ist besser“ hingeben (weil ich das auch nicht so sehe), aber ich kann nicht leugnen, dass sich der Film etwas gehetzt anfühlt. Auch kann ich nicht ungeschehen machen das Buch gelesen zu haben und zu wissen, was der Kürzung zu Opfer fiel. Trotzdem hat der Film ein fabelhaftes Verständnis für Atmosphäre, Bitterkeit wie auch Witz und seine Charaktere. Der Score ist großartig und das Ende geht sogar noch einen Schritt weiter als das Buch. Das macht viel Spaß und ist unheimlich klug inszeniert. Einer der wenigen Filme, bei denen ich mir die Spieldauer länger gewünscht hätte.
Orlando, Großbritannien/Frankreich/Italien/Niederlande/Russland, 1992, Sally Potter, 94 min, (7/10)

Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia
Um den Gefahren des zweiten Weltkriegs zu entkommen, schickt ihre Mutter die vier Geschwister Peter (William Moseley), Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) und Lucy (Georgie Henley) vom unter Beschuss stehenden London aufs Land. Auf dem Anwesen Professor Digory Kirkes (Jim Broadbent) ist wahrlich genug Platz, aber ihr Zuhause ist es eben nicht und die Kinder der einzige gegenseitige Halt in einer Welt voller Veränderung. Beim Versteckspielen landet die kleinste, Lucy, in einem Kleiderschrank, dessen Rückwand eine Tür in eine andere Welt ist: Narnia. Dort trifft sie auf den Faun Herrn Tumnus (James McAvoy), der ihr davon erzählt wie Narnia seit hundert Jahren im eisigen Griff der Hexe Jadis (Tilda Swinton) ist. Die hat sich selbst zur Königin ernannt und obwohl sie eine Schreckensherrschaft führt, Angst vor einer Prophezeiung hat. Nach der sind es nämlich „Kinder Adams“, die den Thron Narnias besteigen. Anfangs glauben die Geschwister Lucy nicht. Bald schon öffnet sich aber auch für die anderen Drei die Tür nach Narnia und sie stellen sich der Prophezeiung – und der Hexe.
Vor den über 15 Jahren als der Film in die Kinos kam, hat Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia sicherlich um einiges anders und besser funktioniert. Was die Effekte betrifft auf jeden Fall. So wurde in den Löwen Aslan (gesprochen von Liam Neeson bzw. Thomas Fritsch) eine Menge Energie gesteckt – und das sieht man auch heute noch. Aslan sieht klasse aus, was man leider nicht von allen tierischen 3D-animierten Figuren sagen kann. Ungebrochen gut funktioniert hingegen das Schauspiel. Wenn Georgie Henley als Lucy Narnia betritt und das erste Mal die schneebedeckten Tannenadeln an ihrer Jacke piksen, dann wirkt das echt. Es war wohl (so sagt man) auch eine echte erste Reaktion auf das Set. Für die Kinder ist Narnia der dringend benötigte Eskapismus. Einerseits die Möglichkeit der Kriegsgegenwart zu entfliehen, andererseits Prophezeiung sei Dank ein bisschen Kontrolle zurückzugewinnen. Hier liegt aber auch das (zumindest für Erwachsene) schwierige Geschmäckle des Films : dass die Kinder letzten Endes in den Krieg ziehen ist doch eine Botschaft, der ich aus heutiger Sicht etwas mehr Reflektion gewünscht hätte.
Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (OT: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe), USA, 2005, Andrew Adamson, 137min, (5/10)

We Need to Talk About Kevin
Manch personifizierter Elternratgeber hat eine Meinung zu allem und versteht sofort, wenn man nur eine Minute der Familie beiwohnt. Hier dürfte aber allen die Sprache wegbleiben. In We Need to Talk About Kevin wohnen wir als Zuschauende der dysfunktionalen Beziehung von Kevin (Jasper Newell, später Ezra Miller) und seiner Mutter Eva (Tilda Swinton) bei. Eva tut sich schwer mit dem Nestbau, der Familiengründung. Sie will das Baby, aber sie findet sich nicht in die Mutterrolle wider. Sie will Nestbau, aber sie will nicht die vorörtliche Kleinstadt-Spießigkeit. Die Beziehung zu ihrem Erstgeborenen ist schwierig, als ob beide auf unterschiedlichen Frequenzen spielen. Kevin scheint Spaß daran zu haben seine Mutter zu terrorisieren und das auch mit voller Absicht auszureizen. Eva fällt es (kein Wunder) schwer Empathie für Kevin aufzubringen. Der Rückblick in das Heranwachsen Kevins wird unterbrochen von der Gegenwart, in der Eva wie eine Geächtete alleine lebt. Was ist vorgefallen?
Regisseurin Lynne Ramsays Film spitzt sich langsam bis zur Katastrophe zu. Wer noch absolut nichts vom Film oder der Literaturvorlage Lionel Shrivers gehört hat, wird sicherlich sehr viele Ideen entwickeln, was eigentlich genau vorgefallen ist bis man es erfährt. Auch wenn die Vermutungen konkreter werden, enttäuscht das Ende nicht in der Art und Weise wie es uns absolut fassungslos macht. Die ganze Zeit fahren dabei in der klugen Inszenierung die Gedanken mit: Wer ist schuld? Hat irgendeiner von beiden angefangen und den Grundstein für die Katastrophe gelegt? Dabei ist es genau das, was der Film uns zu begreiflich machen versucht: es gibt diesen Grundstein nicht. Viel mehr muss der fehlende Schlüsselsatz der Grundstein sein: We Need to Talk About Kevin. Die Auseinandersetzung. Ein unheimlich guter, aber unheimlich unbequemer Film, der viel von dem richtigen Momentum der Erzählung lebt. Und natürlich den fabelhaften Darsteller:innen. Was nicht so ganz funktionieren will ist aber die absolute Abwesenheit aller anderen Personen in der Gleichung bzw. deren absolute Unwissenheit gegenüber der Sachlage.
We Need to Talk About Kevin, USA/UK, 2011, Lynne Ramsay, 112 min, (9/10)

We Need to Talk About Kevin (2011) – US Trailer – HD Movie, Rotten Tomatoes Trailers, Youtube
Memoria
Jessica (Tilda Swinton) reist nach Bogotá, um ihrer kranken Schwester beizustehen. Eines nachts wird sie durch ein dumpfes, lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen, das sie fortan begleitet. Die Störung holt sie immer mal wieder aus ihrem Alltag – und ganz offensichtlich ist sie die einzige, die das Geräusch wahrnimmt. Während ihrer Zeit in Bogotá freundet sie sich mit zwei Menschen an, die ihr auf der Spurensuche nach dem Geräusch mehr oder weniger gewollt Hinweise liefern. Zum Einen die Archäologin Agnes (Jeanne Balibar), zum Anderen der Tontechniker Hernán (Juan Pablo Urrego).
Es ist bewundernswert wie nicht nur der ganze Film, sondern auch die Charaktere darin Stille aushalten. Wühlt man sich ein bisschen durch Letterboxd, liest man heraus, dass es ein ganz anderes Erlebnis gewesen sein muss den Film im Kino zu hören. Sicherlich war da etwas mehr der Lautstärke-Regler aufgedreht als bei mir im Heimkino. Das Geräusch, das Jessica begleitet, hat zwischen den ruhigen Stellen des Films sowieso schon eine faszinierende Wirkung. Mit entsprechend aufgedrehtem Regler vielleicht noch mehr. Es ist aber auch so ein fast kafkaeskes Spiel. Am faszinierendsten war für mich zu sehen in welchen Situationen das Geräusch Jessica begleitet – bei weitem nicht nur in den eigenen vier Wänden.
Memoria schenkt uns nicht besonders viele Hinweise, die bei der Deutung helfen, aber gerade genug, um wieder etwas Magie in unseren Alltag einzuladen. Was wäre, wenn wir alle Sender und Empfänger von Erinnerungen sind? Wir selber die Speicher von Erinnerungen, die länger als unsere eigene Lebensspanne zurückreichen? Ist das Geräusch das letzten Endes gar nicht mal so metaphorische Echo aus der Vergangenheit? Ich gestehe ich fand die eine Szenen gegen Ende doch einen touch too much, mag aber sehr den Gedanken von diesem Hauch Unsterblichkeit und kollektivem Gedächtnis. Aber ohne mutige Entscheidungen gibt es wohl auch kein sense of wonder.
Memoria, Kolumbien/Thailand/Vereinigtes Königreich/Mexiko/Frankreich, 2021, Apichatpong Weerasethakul, 136 min, (8/10)

Three Thousand Years of Longing
Literaturwissenschaftlerin Dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) kann kaum etwas erschüttern – sie hat schon einiges erlebt. Tagträume lässt sie zu, ist aber ansonsten rational durch und durch. Umso kniffliger ist es für sie zu akzeptieren, was passiert, nachdem sie in Istanbul ein Souvenir kauft. Der Flakon ist etwas schmutzig und als sie daran reibt, kommt prompt ein Dschinn (Idris Elba) heraus. Sie wird den Dschinn erst aus ihrem geordneten Leben los, wenn er ihr drei Wünsche erfüllt. Aber Alithea ist clever und weiß ja aus Geschichten, dass das immer für die Wünschenden schief geht. Der Dschinn ist aber sehr daran interessiert freizukommen und erzählt ihr diverse Geschichten, die sie davon überzeugen sollen, dass es nicht im Desaster enden muss.
THREE THOUSAND YEARS OF LONGING | Official Trailer | MGM Studios, MGM, Youtube
Die Geschichten des Dschinns handeln u.a. von der Königin von Saba (Aamito Lagum), von fernen Ländern, Umwälzungen, Krieg und Liebe. Sie sind in phänomenal schöne Bilder gegossen, die fließende Übergänge zwischen Realität und Mythen aufzeigen. Auffällig aber auch: dass die Sagengestalten und Wunder weniger geworden sind mit der Moderne. Der Film ist damit der wohl beste Beweis für seine eigene Theorie: Dass die Moderne die Märchen und Wunder verdrängt. So sitzt man ungeduldig die Geschichten aus, weil man darauf brennt zu erfahren, ob Alithea die Wünsche äußert, nur um dann noch ungeduldiger zu merken, dass der Film noch längst nicht zu Ende ist. In den letzten Minuten holt George Miller dann die Keule raus und überfordert alle mit der plötzlichen, in die letzten Minuten gepressten Agenda einer nochmals anderen überdeutlichen Botschaft. Gepaart mit der nicht so glücklich entwickelten und nicht besonders flirrenden Liebesgeschichte, sitzt man da und ist betört von ganz anderen als man dachte. Von den Geschichten und Bildern mehr aus Orient, denn aus Okzident. Obwohl ich alle Einzelteile wunderbar fand, Tilda Swinton und Idris Elba eingeschlossen, fühlt es sich an wie falsch zusammengepuzzelt. Was gelungen ist: die Regeln der Wünsche und des Geists aus der Flasche von hinten aufgezäunt zu erzählen, ohne dass wir uns wie in der Schulstunde fühlen. Nur was machen wir jetzt mit unserer märchenlosen Welt? Vielleicht öfter ins Kino gehen und davor das Handy ausmachen.
Three Thousand Years of Longing, Australien, 2022, George Miller, 108 min, (7/10)

Es fehlen mir hier natürlich eine Menge Tilda-Klassiker. Zum Beispiel oben erwähnter I am Love oder Only Lovers Left Alive. Oder „Grand Budapest Hotel“. Suspiria ist schon alleine wegen ihrer Mehrfachrolle ein doppelter Hingucker. Wie von Arte in dem oben verlinkten Video so schön erklärt ist Verwandlung wohl das Motiv Tilda Swintons. In ihren Rollen finden sich genauso oft androgyne, ungeschrieben Gesetze brechende Figuren oder auch Mutter- und Frauenrollen, die sich in überweltlichen Situationen wiederfinden. Welcher ist euer Tilda-Klassiker?
„7ème art“ (Sprich: septième art) heißt „siebte Kunst“. Gemäß der Klassifikation der Künste handelt es sich hierbei um das Kino. In dieser Kategorie meines Blogs widme ich mich also Filmen – evtl. dehne ich den Begriff dabei etwas. Regulär stelle ich zwischen dem 1. und 5. jeden Monats jeweils 7 Filme in kurzen Reviews vor.
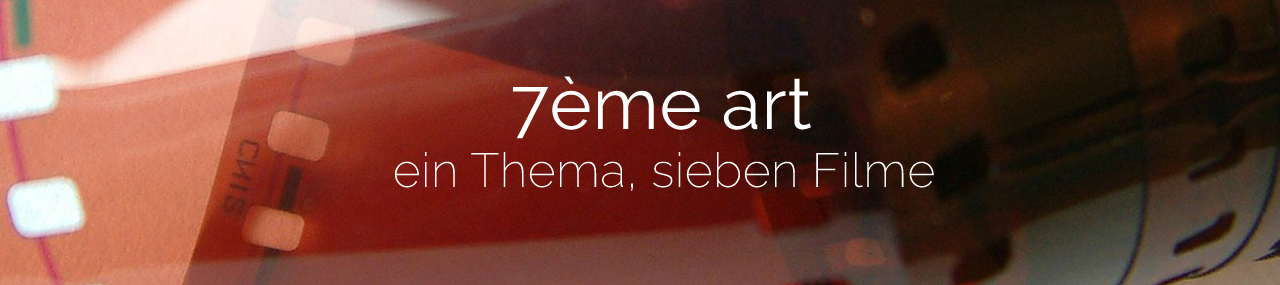
Schreibe einen Kommentar